

»Was ist denn passiert?«
Eltons Antwort wurde von einer Alarmsirene laut
übertönt. Dann kam Abbigens in den Aufenthalts-
raum. Er sah sich triumphierend um und nickte je-
mandem zu. Wem? Glystra warf den Kopf herum. Zu
spät; er sah nur noch Gesichter und offene Münder.
Und jetzt – ein Bild, das er niemals vergessen würde:
die Tür schwang auf, der Maat taumelte herein, die
Hand am Hals, als würde er sich die Kehle reiben. Er
deutete mit einem zitternden Finger auf Abbigens.
Aus seinem Mund quoll Blut; seine Knie gaben nach,
und er fiel zu Boden.
Glystra starrte auf den untersetzten Mann mit den
blonden Haaren. Dunkle Schatten zogen an den
Sichtluken vorbei. Ein furchtbares Krachen; der Bo-
den des Aufenthaltsraums wölbte sich nach oben ...
PLANET DER AUSGESTOSSENEN von Jack Vance,
ein packendes Weltraumabenteuer.

Ullstein Buch Nr. 3256
im Verlag Ullstein GmbH,
Frankfurt/M – Berlin – Wien
Titel der Originalausgabe:
BIG PLANET
Aus dem Amerikanischen
von Michael Pross
Umschlagillustration: ACE
Umschlaggraphik: Ingrid Roehling
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 1957 by Jack Vance
Übersetzung © 1976 by
Verlag Ullstein GmbH,
Frankfurt/M – Berlin – Wien
Printed in Germany 1976
Gesamtherstellung:
Augsburger Druck- und
Verlagshaus GmbH
ISBN 3-548-03256-7
CIP-Kurztitelaufnahme der
Deutschen Bibliothek
Vance, Jack
Planet der Ausgestoßenen:
Science-Fiction-Roman /hrsg. von
Walter Spiegl. – Frankfurt/M.,
Berlin, Wien: Ullstein, 1976.
(Ullstein-Bücher; Nr. 3256:
Ullstein 2000)
Einheitssacht.: Big planet (dt.).
ISBN 3-548-03256-7
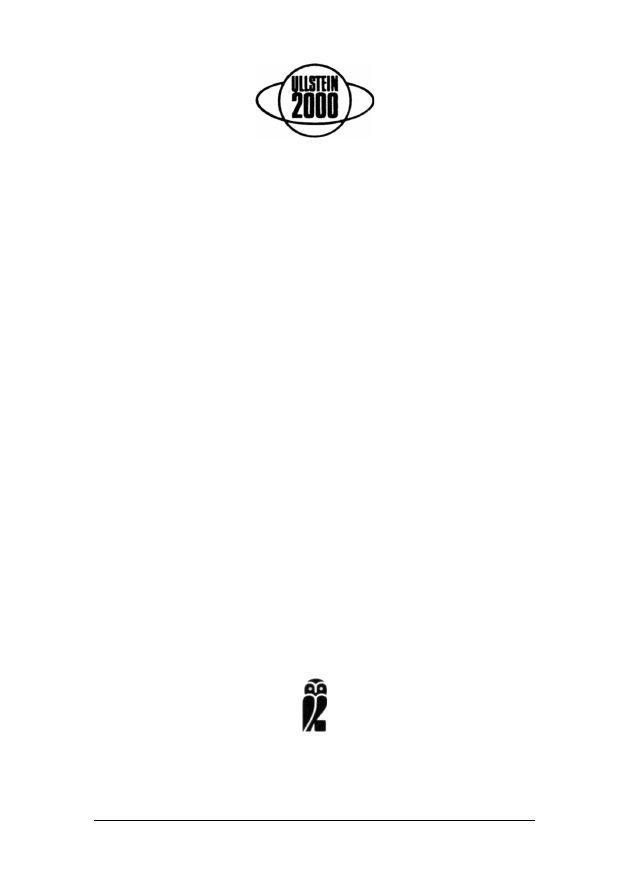
Jack Vance
Planet der
Ausgestoßenen
SCIENCE-FICTION-Roman
Herausgegeben
von Walter Spiegl
ein Ullstein Buch
Dieses E-Book ist nicht zum Verkauf bestimmt!!

1
Er nannte sich Arthur Hidders. Seine Kleidung war
irdischen Zuschnitts, und wenn man von der Länge
seiner Haare und seinem Backenbart absah, unter-
schied er sich nicht im geringsten von einem Erden-
bürger. Er war gut einen Meter achtzig groß und
hellhäutig; seinen großen, rundlichen Kopf
schmückte ein durchaus sensibles Gesicht, dessen
Züge aber etwas zu dicht beieinander lagen.
Er wandte sich von der Raum-Sichtluke ab und sah
den alten Eli Pianza mit einem Ausdruck fast kindli-
cher Durchtriebenheit an. »Das ist alles sehr interes-
sant – aber muß es nicht, nun ja, vergeblich erschei-
nen?«
»Vergeblich?« echote Pianza würdevoll. »Ich
fürchte, das verstehe ich nicht.«
Hidders machte eine achtlose Geste. »Die Erd-
Zentrale hat in den letzten fünfhundert Jahren unge-
fähr während jeder Generation einmal eine Kommis-
sion ausgesandt. Einigen Kommissionen gelang es,
wieder lebend zurückzukehren, den meisten aber
nicht. Auf jeden Fall ist nie etwas dabei herausge-
kommen. Ein paar Erkunder haben ihr Leben verlo-
ren, eine Menge Geld ist weg, man flucht – Verzei-
hung – über die schrecklichen Zustände auf dem
Großen Planeten, und im übrigen geht alles weiter
wie zuvor.«
»Was Sie sagen, ist wahr«, antwortete Pianza, ohne
seinen Gleichmut zu verlieren, »aber diesmal werden
sich die Dinge vollkommen anders entwickeln.«
Hidders zog die Augenbrauen hoch und breitete
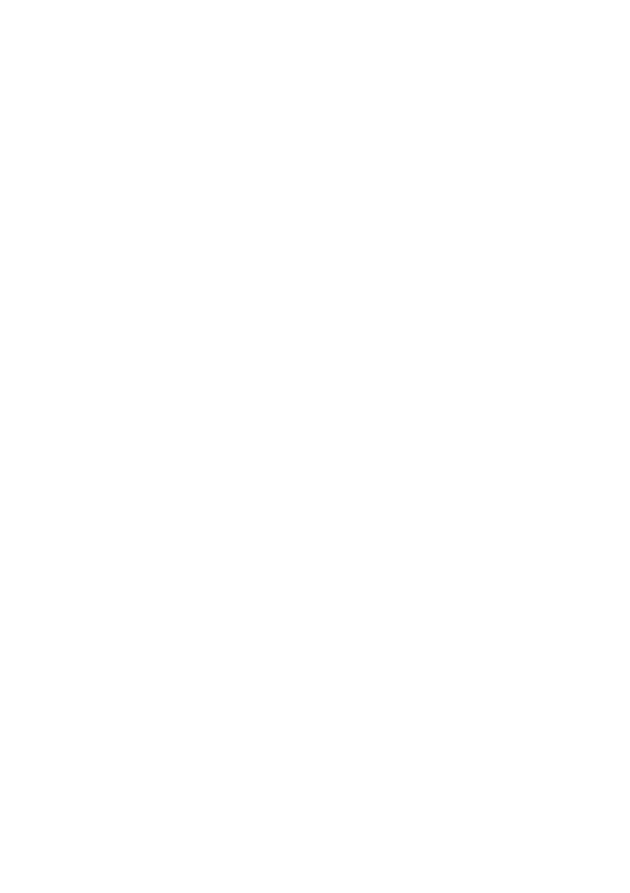
zugleich die Arme aus. »Hat sich der Große Planet
verändert? Oder etwa die Erd-Zentrale?«
Pianza sah sich unbehaglich in dem Aufenthalts-
raum um, in dem sich außer ihnen nur eine Hilfreiche
Schwester aufhielt, die unbeweglich wie eine Statue
dasaß, der sichtbare Teil ihres Gesichts meditativ ent-
rückt.
»Die Bedingungen haben sich geändert«, gab er zu.
»Sehr geändert. Die früheren Kommissionen wurden
ausgesandt, um – nun ja, sagen wir, um das irdische
Gewissen zu beruhigen. Wir wußten, daß auf dem
Großen Planeten Mord, Folterung und Terror Wirk-
lichkeit waren; wir wußten, daß etwas getan werden
mußte.« Er lächelte bedauernd. »Jetzt gibt es etwas
Neues auf dem Großen Planeten: den Bajarnum von
Beaujolais.«
»Ach ja – ich bin oft durch seine Länder gereist.«
»Nun, auf dem Großen Planeten gibt es vermutlich
Hunderte von Herrschern, die nicht weniger grau-
sam, arrogant und willkürlich regieren – aber der
Bajarnum dehnt sein Reich, wie Sie sicher wissen,
ständig weiter aus, und er beschränkt seine Aktivitä-
ten dabei nicht einmal mehr auf den Großen Plane-
ten.«
»Hm«, meinte Hidders. »Sie sind also gekommen,
um sich um Charley Lysidder zu kümmern.«
»Ja, so könnte man das sagen. Und diesmal haben
wir die Befugnis, selbst einzugreifen.«
Ein dunkelhäutiger Mann von mittlerer Größe be-
trat den Aufenthaltsraum. Seine Muskeln lagen dicht
unter seiner Haut, er bewegte sich schnell und mit
scharfen, bestimmten Bewegungen. Es war Claude
Glystra, der Leiter der Kommission.
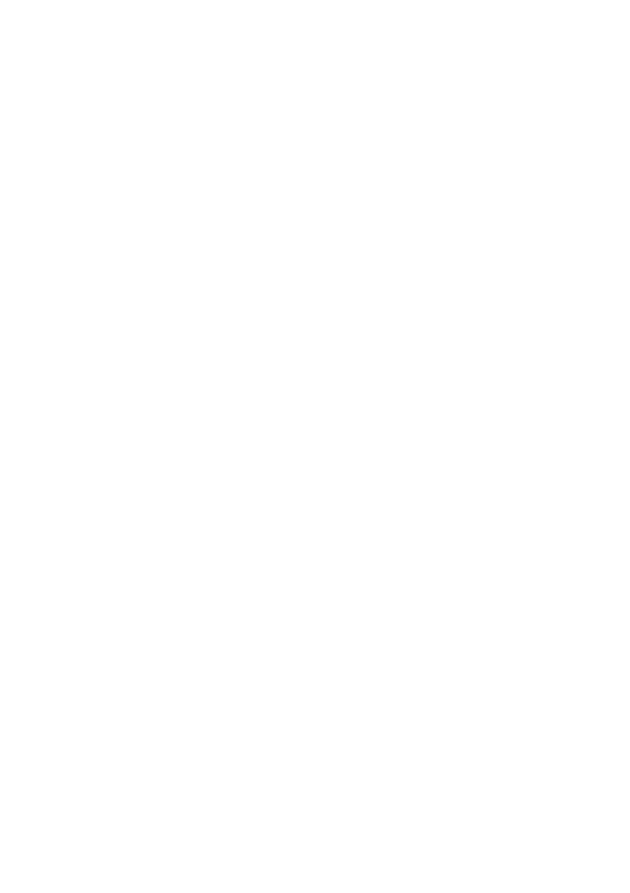
Glystra sah sich mit eisigen, suchenden, fast miß-
trauischen Blicken im Aufenthaltsraum um. Er trat zu
Hidders und Pianza an die Sichtluke und deutete auf
eine flammendgelbe Sonne, von der sie nicht mehr
weit entfernt waren. »Das ist Phaedra. Wir werden
uns in wenigen Stunden auf dem Großen Planeten
befinden.«
Ein Gong ertönte. »Essenszeit«, sagte Pianza und
erhob sich sichtlich erleichtert. Glystra ging den an-
deren voraus, verhielt aber nahe der Tür, um die Hilf-
reiche Schwester in einer Wolke von Schwarz voran-
schweben zu lassen.
»Ein merkwürdiges Geschöpf«, murmelte Pianza.
Glystra lachte. »Auf dem Großen Planeten gibt es
nur merkwürdige Leute; deshalb sind sie dort. Wenn
sie sie missionieren oder auch nur nach ihrer eigenen
Fasson glücklich werden will, so ist das ihr gutes
Recht. Und abgesehen von ihrer Art, sich zu kleiden,
würde sie einem jeden Planeten zur Ehre gereichen.«
Hidders nickte lebhaft. Die Hilfreichen Schwestern
genossen, ähnlich wie die Barmherzigen Schwestern
der Alten Zeit, eine ausgesprochen hohe Wertschät-
zung auf allen zivilisierten Welten. »Vollkommene
Demokratie auf dem Großen Planeten, wie, Mr.
Glystra?«
Pianza sah erwartungsvoll drein; Glystra pflegte
stets in aller Deutlichkeit zu sagen, was er dachte.
Claude Glystra enttäuschte ihn nicht.
»Perfekte Anarchie, Mr. Hidders.«
Schweigend gingen sie die spiralförmige Treppe
zur Kantine hinab und nahmen ihre Plätze ein. Einer
nach dem anderen kamen die übrigen Mitglieder der
Kommission hinzu. Zuerst Roger Fayne, groß, blü-

hend, lebhaft; dann Moss Ketch, dunkel, mürrisch,
melancholisch, gleich dem »Vorher«-Typ in der Wer-
bung für ein Stärkungsmittel. Danach kam Steve Bis-
hop, das jüngste Kommissionsmitglied; hinter seinem
Schafsgesicht und seiner aalglatten Art verbargen
sich ein Kopf voll von Gelehrsamkeit und starke hy-
pochondrische Tendenzen. Er befriedigte das eine mit
einer tragbaren Mikrofilmbibliothek und das andere
mit einem Koffer voll von Medikamenten und In-
strumenten. Zuletzt kam Bruce Carrot, aufrecht, mit
ausgesprochen militärischer Haltung und karotten-
farbenen Haaren. Seine Lippen waren aufeinander-
gepreßt, als müßten sie einen beständigen Tempera-
mentsausbruch verhindern.
Die Mahlzeit verlief ruhig, war aber von einer
Spannung belastet, die den ganzen Nachmittag über
anhielt und immer stärker wurde, während sich der
Große Planet in ihren Sichtbereich schob und diesen
schon bald vollkommen ausfüllte.
Ein scharfer Ruck, ein Schlingern, ein spürbarer
Richtungswechsel. Glystra wich von der Sichtluke
zurück. Das Licht flackerte, erstarb, glomm dann
schwach weiter. Glystra lief die Spirale zur Brücke
hinauf. Auf dem höchsten Absatz stand ein unter-
setzter Mann in einer Schiffsuniform – Abbigens,
Funker und Zahlmeister.
»Was ist los?« verlangte Glystra scharf. »Was ist
passiert?«
»Keine Ahnung, Mr. Glystra. Ich wollte selbst da
hinein; aber die Tür ist verschlossen.«
»Sieht so aus, als wäre das Schiff außer Kontrolle
geraten, als stünde uns eine Bruchlandung bevor.«
»Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Mr.

Glystra. Wir haben eine Notlandeausrüstung, die uns
sicher zu Boden bringen wird – alles automatisch. Die
Landung wird vielleicht ein bißchen hart, aber wenn
wir ruhig im Aufenthaltsraum sitzen bleiben, kann
uns eigentlich nichts passieren.«
Behutsam ergriff er Glystras Arm. Glystra schüt-
telte ihn ab und kehrte zu der Tür zurück; sie war so
fest wie die übrigen Wandungen.
Er rannte die Stufen hinunter, während er sich
selbst vorwarf, nichts gegen eine solche Möglichkeit
unternommen zu haben. Irgendwo auf dem Großen
Planeten außerhalb der Erdenklave zu landen, be-
deutete nichts weniger als eine Katastrophe. Er stand
am Eingang des Aufenthaltsraums; da war ein
Durcheinander von Stimmen, bleiche Gesichter
wandten sich ihm zu. Fayne, Darrot, Pianza, Bishop,
Ketch, Hidders und die Schwester – sie waren alle da.
Er lief zum Maschinenraum; die Tür gab nach. Asa
Elton, der durch nichts zu erschütternde Chefinge-
nieur, schob ihn zurück.
»Wir brauchen die Rettungsboote«, bellte Glystra.
»Keine Rettungsboote mehr.«
»Keine Rettungsboote mehr! Was ist mit ihnen ge-
schehen?«
»Sind ausgeschleust worden. Wir müssen beim
Schiff bleiben, etwas anderes bleibt uns nicht zu tun.«
»Aber der Kapitän, der Maat –«
»Sie antworten nicht.«
»Aber was ist passiert?«
Eltons Antwort wurde von einer Alarmsirene un-
hörbar gemacht.
Abbigens kam in den Aufenthaltsraum. Er sah sich
triumphierend um und nickte jemandem zu. Wem?

Glystra warf den Kopf herum. Zu spät; er sah nur
noch Gesichter und offene Münder.
Und jetzt – ein Bild, das er niemals vergessen wür-
de: die Tür schwang auf; der Maat taumelte herein,
die Hand am Hals, als würde er sich die Kehle reiben.
Er deutete mit einem zitternden Finger auf Abbigens.
Aus seinem Mund quoll Blut; seine Knie gaben nach,
und er fiel zu Boden.
Glystra starrte auf den untersetzten Mann mit den
blonden Haaren.
Dunkle Schatten zogen an den Sichtluken vorbei.
Ein furchtbares Krachen; der Boden des Aufenthalts-
raums wölbte sich nach oben.
Claude Glystra gewann sein Bewußtsein allmählich
wieder wie ein Stück Holz, das sich im Wasser voll-
sog. Er öffnete seine Augen; die Sicht kehrte zurück.
Er lag auf einer niedrigen Bettstelle in einer aus
Brettern gezimmerten Hütte. Mit einer fiebrigen Be-
wegung stützte er sich auf einen Ellbogen und sah zu
der offenen Tür hinaus; und was er sah, wirkte auf
ihn wie der wundervollste Anblick seines Lebens.
Er sah auf einen grünen Hügel hinaus, mit gelben
und
roten
Blumen
besprenkelt,
der
zu
einem
Wald
hin-
aufführte. Durch das Blätterwerk hindurch waren die
Giebel eines Dorfes zu erkennen – schmale Giebel aus
geschnitztem, dunkelbraunem Holz. Die ganze Land-
schaft war wie in ein helles, goldenes Licht getaucht;
jede Farbe erstrahlte mit juwelengleicher Klarheit.
Drei Mädchen in bäuerlicher Kleidung bewegten
sich durch sein Gesichtsfeld; sie tanzten im Kreise.
Glystra hörte die Musik – Ziehharmonika, Mandoline
und Gitarre.

Schritte
näherten
sich.
Aus
nur
halb
geöffneten
Au-
gen nahm er wahr, wie Pianza und Roger Fayne die
Hütte
betraten. Hinter ihnen kam ein junges Mädchen
mit blonden Pferdeschwänzen; sie trug ein Tablett.
Glystra kämpfte sich erneut auf seine Ellbogen,
und Pianza sagte beruhigend: »Entspanne dich,
Claude. Du bist ein kranker Mann.«
»Ist jemand getötet worden?« verlangte Glystra zu
wissen.
»Die Stewards. Sie haben sich im äußeren Bereich
des Schiffs aufgehalten. Und die Schwester ebenfalls.
Offenbar ist sie kurz vor dem Aufprall in ihre Kabine
gegangen. Die befindet sich jetzt sechs bis acht Meter
unter der Erde. Und dann natürlich der Kapitän und
der Maat, denen die Kehle durchgeschnitten wurde.«
Glystra schloß die Augen. »Wie lange ist das jetzt
her?«
»Etwa vier Tage.«
»Was ist passiert?«
»Das Schiff ist völlig hin«, sagte Fayne. Er zog ei-
nen Stuhl heran und setzte sich. »Es ist in drei Teile
zerbrochen. Ein Wunder, daß wir überhaupt lebend
herauskamen.«
Das Mädchen stellte das Tablett auf das Bett, kniete
sich hin und breitete sich darauf vor, Glystra zu füt-
tern. Er sah etwas kläglich hoch. »Und das geht schon
seit vier Tagen so?«
»Du hast Pflege gebraucht«, sagte Pianza. Er strich
dem Mädchen über die Haare. »Das ist Natilien-
Thilssa, oder kürzer Nancy. Sie ist eine gute Schwe-
ster.«
Fayne blinzelte mit den Augen. »Du hast vielleicht
ein Glück.«

Glystra
wich
vor
dem
Löffel
zurück. »Ich kann selbst
essen.« Er sah zu Pianza hoch. »Wo sind wir, Eli?«
Pianza runzelte die Stirn. »Die Ortschaft heißt Jubi-
lith – irgendwo nahöstlich von Beaujolais.«
Glystra preßte die Lippen zusammen. »Es könnte
kaum schlimmer sein. Ich wundere mich, daß sie uns
noch nicht aufgegriffen haben.«
Pianza sah zur Tür hinaus. »Wir sind hier ziemlich
isoliert, und es gibt praktisch keine Kommunikati-
onsmittel ... Aber es hat uns trotzdem ziemlich nervös
gemacht, wie ich zugeben muß.«
Die Szene im Aufenthaltsraum trat vor Glystras in-
neres Auge. »Wo ist Abbigens?«
»Abbigens? Verschwunden.«
Glystra stöhnte und atmete schwer. Pianza sah un-
sicher zu Fayne.
»Warum habt ihr ihn nicht umgebracht?«
Pianza vermochte nur den Kopf zu schütteln. »Er
ist uns entkommen«, sagte Fayne.
»Da war noch jemand anders«, sagte Glystra
schwach.
Eli Pianza lehnte sich nach vorn, seine grauen Au-
gen blickten scharf. »Jemand anders? Wer?«
»Ich weiß nicht. Abbigens hat den Kapitän und den
Maat umgebracht. Der andere hat den Antrieb sabo-
tiert und die Rettungsboote ins All geschickt.« Er
wälzte sich ruhelos auf der Liege hin und her, und
das Mädchen legte eine kühle Hand auf seine Stirn.
»Ich war also vier Tage bewußtlos. Ist das nicht un-
gewöhnlich lange?«
»Du
hast
unter
dem
Einfluß
von Beruhigungsmitteln
gestanden«, erklärte Pianza. »Du hast dringend Ruhe
gebraucht. Eine Zeitlang warst du wie wahnsinnig.«

2
Glystra setzte sich auf, obwohl Nancy ihn zurückzu-
halten versuchte, und befühlte seinen Kopf. Er ver-
suchte, auf die Füße zu kommen. Fayne sprang auf.
»Um Himmels willen, Claude, mach mal langsam!«
Glystra schüttelte den Kopf. »Wir müssen hier
raus. Und zwar schnell. Überleg doch mal. Wo ist
Abbigens? Er ist abgehauen, um Charley Lysidder
Bericht zu erstatten, dem Bajarnum.« Er ging zur Tür
und badete sich in den weiß-goldenen Sonnenstrah-
len, nahm den Anblick der Landschaft des Großen
Planeten in sich auf. Pianza schaffte einen Stuhl her-
bei; Glystra ließ sich darauf nieder.
Die Hütte, das Dorf und der Wald befanden sich in
halber Höhe einer Hügelformation, deren Größe sich
irdischen Vorstellungen entzog. Oberhalb vermochte
Glystra keine scharfe oder kammartige Begrenzung
zu erkennen; das Land floß in die blaßblaue Ferne
hinein.
Fayne hielt seine schweren Arme in die wärmende
Sonne. »Hierher werde ich ziehen, wenn ich alt bin.
Wir hätten den Großen Planeten niemals diesen Ver-
rückten überlassen sollen.«
Nancy ging mit etwas steifen Bewegungen ins
Haus zurück.
Roger Fayne kicherte. »Vermutlich hat sie ange-
nommen, daß ich sie auch zu den Verrückten zähle.«
»Du wirst niemals alt werden, Roger«, sagte
Glystra, »wenn wir hier nicht bald herauskommen.
Wo ist das Schiff?«
»Ein Stück weit in dem Wald da oben.«

»Wie weit sind wir von Beaujolais entfernt?«
Fayne blickte in Richtung Südwesten den Abhang
hinauf. »Die Grenzen von Beaujolais lassen sich nicht
so genau bestimmen. Jenseits dieser Erhebung befin-
det sich ein weites Tal offenbar vulkanischen Ur-
sprungs. Es soll voll von heißen Quellen, Geisiren,
sein – das Tal der Glasbläser. Letztes Jahr ist der Ba-
jarnum mit seinen Truppen eingerückt, und seither
gehört das Tal zu Beaujolais. Bis heute hat er noch
keinen Statthalter oder Steuereintreiber nach Jubilith
gesandt, aber sie werden jeden Tag erwartet – zu-
sammen mit einer Garnison.«
»Wozu eine Garnison? Um die vielzitierte Ruhe
und Ordnung aufrechtzuerhalten?«
Fayne deutete hangabwärts. »Zum Schutz vor den
wilden Nomaden, die sich gern als Sklavenjäger be-
tätigen – sie werden Zigeuner genannt.«
Glystra blickte zu der Stadt hinauf. »Sieht nicht so
aus, als ob sie darunter sehr gelitten hätten ... Wie
weit ist Grosgarth entfernt?«
»Es liegt schätzungsweise etwa zweihundert Mei-
len südlich. Eine Garnisonsstadt – sie wird Montmar-
chy genannt – befindet sich etwa fünfzig Meilen süd-
östlich am Rand der Hügelformation entlang.«
»Fünfzig Meilen«, überlegte Glystra. »In diese
Richtung hat sich vermutlich Abbigens auf den Weg
gemacht, um ...« Ein dumpfes, metallisches Geräusch
war vom Wald her zu vernehmen. Glystra sah Pianza
fragend an.
»Sie schneiden das Schiff auseinander. Es ist mehr
Metall, als sie in ihrem ganzen Leben gesehen haben.
Wir haben sie alle zu Millionären gemacht.«
»Bis der Bajarnum das ganze Ding beschlag-

nahmt«, ergänzte Fayne.
»Wir müssen hier raus«, murmelte Glystra und
bewegte sich in seinem Stuhl. »Wir müssen es bis zur
Enklave schaffen – irgendwie ...«
Pianza preßte die Lippen aufeinander. »Der näch-
ste Weg dahin geht um den ganzen Planeten, und das
sind vierzigtausend Meilen.«
Glystra erhob sich mühsam. »Wir müssen hier
raus. Wir sitzen hier wie Tontauben zum Abschießen.
Wenn sie uns kriegen, dann wird Lysidder ein Exem-
pel an uns statuieren ... Wo sind eigentlich die ande-
ren aus dem Schiff?«
Pianza nickte in Richtung auf das Dorf. »Sie haben
uns ein großes Haus überlassen. Hidders ist weg.«
»Weg? Wohin?«
»Grosgarth. Er sagte, er will zum Golf von Marwan
übersetzen und sich einer der Strandkarawanen nach
Wale anschließen.«
»Hmm. Die Stewards tot, der Kapitän und der
Maat tot, die Schwester tot, Abbigens weg, Hidders
weg«, – Glystra zählte sie an seinen Fingern ab –
»bleiben also noch acht; die Kommission und zwei
Offiziere aus dem Maschinendeck. Bringt sie am be-
sten hier runter, und dann werden wir Kriegsrat hal-
ten.«
Sorgenvoll sah Glystra Pianza und Fayne nach, wie
sie zum Dorf hinaufstiegen, ließ seinen Blick sodann
hangabwärts schweifen. Wenn sich Truppen von Be-
aujolais bei Tage näherten, dann waren sie auf viele
Meilen auszumachen. Glystra dachte dankbar daran,
daß die Kruste des Planeten keine Metalle enthielt;
ohne Metalle keine Maschinen, ohne Maschinen keine
Elektrizität – daher auch keine Kommunikation über

weite Entfernungen hinweg.
Nancy kam aus der Hütte heraus; sie hatte ihr ab-
getragenes blaues Kleid durch eine Art von Hosenan-
zug ersetzt, einen in Rot und Blau gemusterten Har-
lekinanzug. Eine enganliegende Kappe bedeckte ihre
Haare.
Claude Glystra starrte sie einen Augenblick lang
an. Nancy wirbelte vor ihm herum und zog eine Pi-
rouette – auf einer Zehenspitze balancierend, den an-
deren Fuß am Knie angelegt. »Sind alle Mädchen von
Jubilith so liebreizend wie du?«
Sie lächelte und ließ ihr Gesicht von der Sonne be-
scheinen. »Ich bin nicht von Jubilith ... Ich komme aus
dem Ausland.«
»Tatsächlich. Von woher?«
Sie wies in Richtung Norden. »Von Veillevaux im
Walde. Mein Vater hatte die Gabe der Prophetie, und
die Leute kamen von weither, um nach ihrer Zukunft
zu fragen.«
»Mein Vater wurde reich«, fuhr Nancy fort. »Er
bildete mich in den Künsten aus. Ich reiste nach
Grosgarth und Calliope und Wale, und durch die
Stemvelt-Kanäle ging ich ins Ausland als Sängerin.
Ich war bei den besten Spielgesellschaften, und zu-
sammen kamen wir durch viele Städte und Burgen
und wundervolle Landschaften.« Sie erbebte sicht-
lich. »Und wir haben auch Schlimmes gesehen. Viel
Schlimmes in Claythree ...« Tränen traten in ihre Au-
gen. Mit ausdrucksloser Stimme fuhr sie fort: »Bei
meiner Rückkehr in die Heimat fand ich nur noch
Niedergang und Verzweiflung. Die Zigeuner aus der
Nordheide hatten das Dorf überfallen und das Haus
meines Vaters, in dem sich meine ganze Familie be-

fand, niedergebrannt. Und ich ging nach Jubilith, um
tanzen zu lernen und meine Trauer hinwegzutanzen
...«
Glystra musterte sie genauer. Sie hatte einen ausge-
sprochen lebhaften Ausdruck – ihre Augen blitzten,
ihre Stimme trällerte geradezu, wenn sie von etwas
Freudigem sprach – ihre Lippen bewegten sich flie-
ßend. Und wenn sie von Trauer sprach, dann wurden
ihre Augen ganz groß und nachdenklich.
»Und warum wurdest du damit betraut, mich zu
pflegen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich bin eine Fremde
hier; ich kenne die Lehren von Grosgarth – die teil-
weise aus irdischen Büchern abgeleitet wurden. Nai-
suka.«
Glystra sah erstaunt hoch und wiederholte das
Wort. »Was bedeutet das?«
»Es ist ein Wort, das in Beaujolais gebraucht wird.
Es bedeutet – nun ja, was immer einen Menschen da-
zu bringt, Dinge zu tun, die keinen besonderen
Grund haben.«
Er deutete den Abhang hinab. »Wie heißt das Land
dort unten?«
Sie wandte sich um. »Das Gebiet von Jubilith endet
bei den Wäldern von Tsalombar.« Sie wies auf die
ferne Silhouette einer Waldregion. »Dort wohnen die
Baumleute.«
Beim Dorf oben wurden jetzt die Erdbewohner
sichtbar. Claude Glystra sah zu, wie sie näherkamen.
Keiner wirkte auch nur im entferntesten schuldbe-
wußt; aber jemand hatte Abbigens geholfen, und je-
mand anders hatte den Antrieb außer Funktion ge-
setzt. Das konnte natürlich Arthur Hidders gewesen

sein, und der war jetzt weg.
»Setzt euch«, sagte Glystra. Sie setzten sich ins
Gras. Glystra zögerte, bevor er sich den anderen zu-
wandte. »Wir sind ziemlich übel in der Klemme, aber
ich glaube ja nicht, daß ich das näher ausführen
muß.«
Keiner sagte etwas.
»Unser Schiff ist ein Wrack, und auf Hilfe von der
Erde können wir nicht hoffen. Was die technische
Überlegenheit angeht, so sind wir nicht besser dran,
als die Leute aus dem Dorf. Vielleicht schlechter. Sie
sind den Umgang mit ihren Werkzeugen und Mate-
rialien gewohnt; wir nicht. Wenn wir unbegrenzt Zeit
hätten, dann könnten wir vielleicht eine Art von Sen-
der zusammenbasteln und damit die Enklave zu er-
reichen versuchen. Diese Zeit haben wir nicht. Wir
müssen in jeder Minute damit rechnen, von Soldaten
überrascht und nach Grosgarth gebracht zu werden ...
Wir haben nur eine Chance, und die besteht darin,
aus Beaujolais herauszukommen, soviele Meilen wie
möglich hinter uns zu bringen.«
Er hielt inne und sah einen nach dem anderen an.
Pianza ließ sich wenig anmerken; Faynes breite Stirn
war in tiefe Falten gelegt; Ketch hörte nicht auf, mit
einem kantigen Stein Furchen in den Boden zu zie-
hen. Bishops Gesicht wirkte sorgenumwölkt; über
seinen Augen hatten sich kleine Runzeln ähnlich um-
gekehrten V gebildet. Darrot fuhr sich mit der Hand
durch seine spärlichen roten Haare und murmelte
etwas zu Ketch, der dazu nickte. Elton, der Chefinge-
nieur, saß still da, als ginge ihn das alles nichts an.
Vallusser, der zweite Ingenieur, starrte Glystra an,
als wäre er der Grund all seiner Schwierigkeiten. Er

fragte mit belegter Stimme: »Was machen wir dann?
Wohin sollen wir flüchten? Da draußen« – er wies
den Hang hinunter – »sind doch nur Wilde. Sie wer-
den uns umbringen. Einige von ihnen halten Sklaven,
aber das ist wenig besser.«
Glystra zuckte mit den Schultern. »Jeder kann na-
türlich machen, was er will, um seine eigene Haut zu
retten. Was mich angeht, ich sehe einen Ausweg. Es
ist ein harter, langer und gefährlicher Weg. Vielleicht
unmöglich. Es ist fast sicher, daß nicht alle von uns es
schaffen werden. Aber wir wollen mit unserem Leben
davonkommen; wir wollen nach Hause. Das ist« – er
betonte diese Worte besonders – »ein ganz bestimm-
ter Ort auf dem Großen Planeten. Die Enklave. Wir
müssen die Enklave erreichen.«
»Klingt gut«, meinte Fayne. »Ich bin dafür. Aber
wie machen wir das?«
Glystra grinste. »Mit dem einzigen Fortbewe-
gungsmittel, das wir haben – nämlich unsere Füße.«
»Füße?« Faynes Stimme geriet in eine höhere Ton-
lage.
»Hört sich nach einem ziemlich langen Marsch an«,
sagte Darrot.
Glystra zuckte die Schultern. »Wir brauchen uns
nichts vorzumachen. Wir haben nur eine Chance, zur
Erde zurückzugelangen – und die besteht darin, die
Erdenklave zu erreichen.«
»Aber vierzigtausend Meilen?« klagte Fayne. »Ich
bin ja nicht gerade leicht und auch nicht so gut auf
den Füßen.«
»Wir werden uns Packtiere zulegen«, sagte Glystra.
»Indem wir sie kaufen, stehlen oder wie auch im-
mer.«

»Aber vierzigtausend Meilen.«
Glystra nickte. »Es ist ein weiter Weg. Aber wenn
wir einen entsprechenden Fluß finden, werden wir
eine Floßfahrt machen. Oder vielleicht können wir
uns zum Schwarzen Ozean durchschlagen, dort ein
Schiff auftreiben und um die Küste herumsegeln.«
»Unmöglich«, sagte Bishop. »Die australische
Halbinsel können wir nicht umschiffen, zumal sie
noch einen scharfen östlichen Ausläufer hat. Wir
müßten also zunächst bis Henderland und dann zum
Meer – um die Blackstone-Kordilleren herum bis zum
Parmarbo. Und nach dem Almanach des Großen Pla-
neten ist der Parmarbo praktisch nicht schiffbar auf-
grund von Riffen, Piraten, fleischfressenden Seeane-
monen und wöchentlichen Hurrikanen.«
Roger Fayne stöhnte wiederholt auf. Auch Nancy
gab einen Laut von sich; ihr bebender Mund verriet
Glystra, daß sie ein Kichern zu unterdrücken ver-
suchte. Er erhob sich, und Pianza sah ihn zweifelnd
an. »Wie fühlst du dich, Claude?«
»Schwach. Aber morgen bin ich bestimmt wieder
wie neu. Mir fehlt nichts, was nicht mit ein bißchen
Übung behoben werden könnte. Wir haben eines, wo-
für wir dankbar sein können –«
»Was ist das?« fragte Fayne.
Glystra wies auf seine Füße. »Gute Stiefel. Wasser-
dicht und dauerhaft. Die werden wir auch brauchen.«
Fayne musterte seinen eigenen Körper. »Ich glaube,
meinen Bauch werde ich loswerden.«
Glystra sah sich im Kreise um. »Hat noch jemand
eine Idee? Vallusser?«
»Ich bleibe bei euch.«
»Gut. Hier also das Programm. Wir müssen unser

Gepäck herrichten. Wir nehmen soviel Metall mit, als
wir ohne Schwierigkeiten tragen können; es ist äu-
ßerst wertvoll auf dem Großen Planeten. Jeder von
uns sollte etwa sechs bis sieben Kilo nehmen können.
Messer und Werkzeuge wären am besten, aber wir
werden nehmen müssen, was geht ... Dann brauchen
wir Kleider, und zwar jeweils ein Stück zum Wech-
seln. Eine Schiffahrtskarte des Großen Planeten, wenn
eine aufzutreiben ist. Einen Kompaß. Jeder sollte sich
ein gutes Messer, eine Decke und – das ist am wich-
tigsten – Handwaffen aussuchen. Hat sich schon je-
mand im Schiff umgesehen?«
Elton langte in seine Jackentasche und ließ den
schwarzen Lauf einer Ionenpistole sichtbar werden.
»Hat dem Kapitän gehört. Ich habe mir erlaubt, das
Ding an mich zu nehmen.«
»Ich habe bereits zwei solche Dinger«, fügte Fayne
hinzu.
»In meiner Schiffskabine sollte sich noch ein Io-
nenentlader befinden«, sagte Pianza. »Gestern war
der Zugang noch versperrt, aber vielleicht komme ich
doch noch irgendwie hinein.«
»In meiner Kabine ist noch eine Waffe«, erklärte
Glystra.
Die sieben Männer strebten hangauf, in den sei-
denblauen bis grünen Wald hinein. Glystra sah ihnen
von der Tür aus nach.
Nancy erhob sich. »Du solltest jetzt am besten
schlafen.«
Er ging hinein und ließ sich auf die Liegestatt nie-
der. Nancy stand daneben und sah ihn sinnend an.
»Claude Glystra.«
»Was willst du?«

»Kann ich mitgehen?«
Er wandte den Kopf und sah sie erstaunt an. »Mit-
gehen – wohin?«
»Wohin immer du gehst.«
»Um den ganzen Planeten?«
»Ja.«
Er schüttelte entschieden Kopf. »Du würdest mit
uns zusammen den Tod finden. Unsere Chance steht
nur tausend zu eins.«
»Das ist mir egal ... ich sterbe nur einmal. Und ich
möchte einmal die Erde sehen. Ich bin weit gereist,
und ich weiß von vielen Dingen ...«
Glystra versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Es
gelang ihm nicht, er war zu erschöpft. Irgend etwas
stimmte nicht. Er musterte ihr Gesicht; war sie viel-
leicht in ihn vernarrt? Sie errötete.
»Du errötest leicht«, bemerkte Glystra.
»Ich bin stark. Ich kann die gleiche Arbeit verrich-
ten wie Ketch oder Bishop.«
»Ein hübsches Mädchen kann auch eine Menge
Ärger machen.«
Sie zuckte die Schultern. »Frauen werdet ihr über-
all auf dem Großen Planeten finden.«
Glystra ließ sich auf die Liege zurücksinken und
schüttelte erneut den Kopf. »Du kannst nicht mit uns
kommen, Nancy.«
Sie beugte sich nach vorn. »Sag ihnen, daß ich euch
den Weg zeigen werde. Kann ich nicht bis zum Wald-
rand mitkommen?«
»Gut. Bis zum Waldrand.«

3
Glystra schlief eine Stunde, zwei Stunden, sein Kör-
per saugte die erholsame Ruhe in sich auf. Als er
wieder erwachte, fiel die Nachmittagssonne wie eine
Flut von Saffran durch die Tür herein. Hangaufwärts
sah er, wie die Dörfler ihren abendlichen Reigen voll-
führten. Reihen von Mädchen und jungen Männern
in buntgesprenkelten Anzügen, ähnlich dem von
Nancy, bewegten sich tanzend und springend hin
und her. Glystras Ohren vernahmen eine lebhafte
Tanzmusik, die mit Fiedeln, Ziehharmonikas und
Gitarren gespielt wurde. Mit weitausholenden
Schritten liefen und sprangen die Tänzer innerhalb
seines Gesichtsfeldes hin und her.
Pianza und Darrot sahen durch die Tür zu ihm
herein. »Aufgewacht, Claude?« fragte Pianza.
Glystra schwang sich über den Rand der Liegestatt
hinweg und auf die Füße, setzte sich auf. »Bin so gut
wie neu.« Er stand auf, streckte sich und strich sich
über den Hinterkopf; die Spuren seiner Verwundung
waren fast völlig vergangen. »Alles bereit?«
Pianza nickte. »Wir können gehen. Wir haben dei-
nen Ionenstrahler gefunden und außerdem noch ein
Hitzegewehr, das dem Maat gehörte.« Er sah Glystra
nicht direkt an. »Wenn ich es richtig mitbekommen
habe, dann wird Nancy an der Expedition teilneh-
men.«
»Nein«, sagte Glystra. »Ich habe ihr gesagt, daß sie
bis zum Wald mitkommen kann – das ist nur zwei
oder drei Stunden von hier entfernt.«
Eli Pianza blickte skeptisch drein. »Sie hat bereits
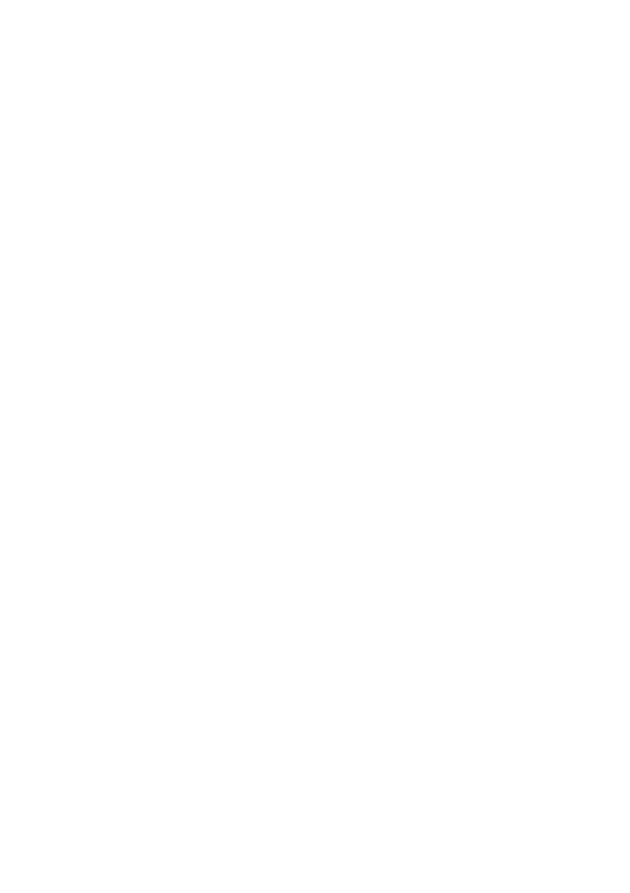
ihr Tragegepäck zusammengestellt. Sie sagte, sie will
mit uns gehen.«
Darrot bewegte verneinend den Kopf hin und her.
»Ich mag das nicht, Claude. In unserer Marschgruppe
ist kein Platz für ein Mädchen. Das führt nur zu Rei-
bungen und Unzufriedenheiten.«
»Ich stimme da voll mit dir überein, Bruce«, sagte
Glystra. »Ich habe ihr Ansinnen rundweg abgelehnt.«
»Aber sie hat schon alles zusammengepackt«, sagte
Pianza.
»Wenn sie uns mit dreißig Metern Abstand folgt,
dann wüßte ich nicht, wie wir sie aufhalten sollten,
ohne körperlichen Zwang anzuwenden.«
Pianza blinzelte mit den Augen. »Nun ja, natürlich
...« Seine Stimme verlor sich.
Darrot war noch immer nicht überzeugt. »Sie ist
weit gereist; sie war in Grosgarth. Sie könnte eine
Geheimagentin des Bajarnum sein. Wie ich gehört
habe, sind seine Spione überall – selbst auf der ande-
ren Seite des Planeten; selbst auf der Erde.«
»Möglich. Es könnte aber auch sein, daß du für den
Bajarnum arbeitest. Einer von uns steht auf jeden Fall
in seinen Diensten.«
Darrot schnaufte verächtlich und wandte sich ab.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Glystra und klopfte
ihm auf die Schultern. »Wenn wir den Wald erreicht
haben, dann schicken wir sie zurück.« Er ging zur
Tür und trat durch sie hindurch ins Freie.
»Bishop hat den Ersten-Hilfe-Kasten aus dem Schiff
gerettet«, berichtete Pianza, »mit all den Nahrungs-
konzentraten und Vitaminpillen. Wir werden es
brauchen können; was wir zu Essen bekommen, wird
nicht immer das Beste sein.«

»Gut.«
»Fayne hat seine Campingausrüstung gefunden,
und wir werden den Kocher und den Wasserbereiter
mitnehmen.«
»Und wie steht es mit Energiereserven für die Io-
nenstrahler?«
»Nichts.«
Glystra kaute auf seinen Lippen herum. »Das ist
schlecht ... Habt ihr die Leiche der Schwester gefun-
den?«
Pianza schüttelte den Kopf.
»Schade«, meinte Glystra, obwohl er es nur wenig
bedauerte. Die Frau war kaum als menschliches We-
sen existent gewesen, was ihn anging; er erinnerte
sich nur an ein schmales weißes Gesicht, einen
schwarzen Umhang und eine schwarze Kapuze, und
an ein Flair der Weltabgewandtheit; davon war jetzt
nichts mehr da.
Vom Dorf her näherten sich die Erdenmänner,
während die Tänzer mit fröhlichen und theatrali-
schen Bewegungen um sie herumsprangen, nur auf
ihre eigenen Bewegungen und auf die Musik achtend.
Da waren Ketch, Elton, Vallusser, Fayne, Bishop –
und Nancy. Sie stand ein wenig abseits, verfolgte die
Tänze mit gelöster Distanz, als wäre sie bereits aller
Bänder ledig, die sie zu Jubilith unterhalten hatte.
Glystra sah über den Großen Planeten hinweg, der
jetzt bereits in dunkles Gold getaucht zu sein schien.
Während er den weiten Abhang hinabsah, fühlte er
sich seiner Sache plötzlich nicht mehr so sicher. Jubi-
lith erschien ihm warm und behaglich und sicher, fast
wie ein Zuhause. Vor ihm lag nur eines – die Weite.
Vierzigtausend Meilen, dachte er; einmal um die Erde

herum, und dann noch einmal halb so weit ...
Wenn er dorthin sah, wo sich der Horizont der Er-
de befunden hätte, dann konnte er den Blick anheben
und über die Lande hinwegsehen, die viel weiter
reichten; Bleistiftlinien in subtilen Schattierungen, je-
de Linie eine Ebene oder ein Wald, ein See, eine Wü-
ste, eine Bergkette ... Er ging einen Schritt, sah über
die Schulter zurück. »Laßt uns gehen.«
Noch lange hörten sie die Musik der Dörfler hinter
sich. Erst als die hellviolette Dämmerung über sie
hereinfiel, lösten sich die Geräusche in der Stille der
Entfernung. Der Weg führte gleichmäßig abwärts,
daher machte ihnen auch die langsam einsetzende
Dunkelheit kaum zu schaffen.
Fayne und Darrot gingen der Gruppe voran; es
folgte Glystra, mit Nancy auf der einen und Pianza
auf der anderen Seite. Ein wenig links von ihnen ging
Ketch; hinter ihnen folgte Bishop, die Augen auf den
Boden gerichtet. In weiteren zwanzig Schritten Ab-
stand folgten Elton, der leichten Schrittes voranging,
und Vallusser, der vorsichtig seinen Weg suchte, als
hätte er einen verletzten Fuß.
Das Zwielicht löste sich auf, und die Sterne er-
schienen. Jetzt gab es nur noch die Dunkelheit, den
Himmel, den Planeten – und sie selbst.
Nancy hatte die ganze Zeit kaum ein Wort gesagt,
aber jetzt, da es dunkel geworden war, hielt sie sich
dichter bei Glystra. Mit tiefer und weicher Stimme bat
sie ihn: »Sag mir, welcher dieser Sterne ist die Alte
Sonne?«
Glystra suchte den Himmel ab. Die Konstellationen
waren ihm fremd, und er konnte kein bestimmtes
Muster erkennen.

Er versuchte sich an ihren Flug und die Flugrich-
tung zu erinnern. »Ich glaube, das dort ist die Sonne –
direkt über dem hellen weißen Stern, in Richtung auf
diesen Spiralnebel.«
Sie starrte mit geweiteten Augen gegen den Him-
mel. »Erzähl mir von der Erde.«
»Es ist unser Zuhause«, sagte Glystra. Er sah ein
paar Sekunden lang zu dem weißen Stern auf. »Was
gäbe ich dafür, wenn ich jetzt dort wäre ...«
»Ist die Erde schöner als der Große Planet?«
»Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, nein.
Der große Planet ist ... groß. Und eindrucksvoll. Die
Himalaya-Berge auf der Erde sind kleine Hügel im
Vergleich zur Sklaemon-Kette hier oder zu den Black-
stone-Kordilleren.«
»Wo befinden sie sich?«
Glystras Gedanken waren abgewandert. »Was?«
»Die Bergketten.«
»Die Sklaemon-Kette liegt etwa dreißigtausend
Meilen nordwestlich in einem Gebiet des Großen Pla-
neten, das Matador genannt wird. Dort leben die so-
genannten Ski-Menschen, glaube ich. Die Blackstone-
Kordilleren sind etwa fünftausend Meilen südöstlich
gelegen, in Henderland oberhalb der australischen
Halbinsel.«
»Es gibt so viel zu lernen ... so viele Orte zu sehen
...« Ihre Stimme wurde ein wenig brüchig. »Die Er-
denmenschen wissen mehr über uns, als wir selbst
wissen. Das ist nicht fair.«
Glystra lachte. »Der Große Planet ist ein Kompro-
miß aus den Ideen der verschiedensten Leute. Nie-
mand kann das für richtig halten.«
»Wir wachsen als Barbaren auf«, erklärte sie mit

nachdrücklicher Betonung. »Mein Vater ...«
Glystra sah sie überrascht an. »Ein Barbar kann sich
dessen nicht bewußt sein, daß er ein Barbar ist.«
»... wurde umgebracht. Überall ist Mord und Tot-
schlag ...«
Glystra tat sein bestes, um seiner Stimme nichts
anmerken zu lassen. »Es ist nicht eure Schuld, daß
das so ist – aber es ist auch nicht die Schuld der Er-
denmenschen. Wir haben es niemals angestrebt, un-
sere Regierungsautorität hier anzuwenden. Jeder, der
nach hier kommt, ist in jeder Hinsicht auf sich selbst
gestellt – und seine Kinder bezahlen den Preis dafür.«
Nancy verneinte mit einem Kopf schütteln.
Glystra versuchte die Sache noch einmal zu durch-
denken. Er verabscheute es nicht weniger als sie,
wenn Menschen Schmerzen zugefügt und sie ins
Elend gestoßen wurden. Aber er war gleichermaßen
davon überzeugt, daß die Erdregierung ihre Autorität
nur innerhalb eines begrenzten Raums aufrechter-
halten konnte. Ebenso war es unmöglich, die Leute
zurückzuhalten, die die Grenzen passieren und sich
als frei erklären wollten. Er mußte sich zugeben, daß
möglicherweise viele unter den Fehlern einiger weni-
ger zu leiden hatten.
Nancy hatte die Ungerechtigkeit kennengelernt –
den kaltblütigen Mord, die Trauer, den Zorn, die
Fehlentwicklungen, die sich im Verlauf der Genera-
tionen verstärkt und nach und nach alle Stämme,
Völker, Rassen, Kontinente, eine ganze Welt angegrif-
fen hatten. Diese Dinge beherrschten natürlich ihre
Gedanken, und es war nicht leicht, ihr die Zusam-
menhänge verständlich zu machen.
»Die irdische Bevölkerung, Nancy, hat sich seit un-

seren ersten archaischen Geschichtsepochen auf ver-
schiedenen Ebenen entwickelt. Einigen Leuten gelang
es, in vollkommener Harmonie mit ihrer Zeit zu le-
ben, andere tragen einen Kern nonkonformistischer
Unabhängigkeit in sich – eine offenbar angeborene
Eigenschaft, ein grundlegender Instinkt wie Hunger,
Furcht, Zuneigung. Diese Leute fühlen sich unglück-
lich und unsicher in einer starren Gesellschaft; durch
alle Zeiten hindurch waren sie diejenigen, die sich
nicht einordnen ließen. Sie waren die Pioniere, die
Forscher, die Eroberer; die Philosophen, die Krimi-
nellen, die Propheten des Untergangs und die Vor-
läufer neuer kultureller Entwicklungen.«
Sie schritten durch die Dunkelheit voran. Der Bo-
den unter ihren Füßen knirschte. Vor und hinter ih-
nen waren unterdrückte Stimmen zu vernehmen.
Nancy, die noch immer zur Alten Sonne hochsah,
erwiderte: »Aber was haben diese Leute denn mit
dem Großen Planeten zu tun?«
»Jubilith«, erklärte Glystra, »wurde von einer Bal-
lettgruppe gegründet, die es offenbar nach Einsam-
keit, Ruhe und Frieden verlangte, um ihre Kunst zur
Vollendung bringen zu können. Vielleicht wollten sie
nur für ein oder zwei Jahre nach hier kommen, aber
sie blieben. Die ersten Siedler, die vor fast sechshun-
dert Jahren nach hier kamen, waren Primitivisten –
Leute, die Maschinen verabscheuten, von einfachen
Karren vielleicht abgesehen. Primitivisten sind auf
der Erde zwar nicht verboten, aber sie wurden wie
Halbverrückte behandelt. Also kauften sie sich ein
Schiff und unternahmen einen Erkundungsflug über
die Grenzen des Systems hinaus. Sie fanden den Gro-
ßen Planeten. Zuerst dachten sie, er wäre zu groß, um

bewohnbar zu sein ...«
»Warum das?«
»Schwerkraft«, erklärte Glystra. »Je größer ein Pla-
net ist, desto stärker die Gravitation. Aber der Große
Planet besteht aus leichteren Materialien, deren spezi-
fische Schwerkraft nur etwa ein Viertel von der der
Erde beträgt. Die Erde ist ein sehr dichter Planet, der
mit ziemlichen Mengen von Metall und schweren
Elementen gesegnet ist, daher beträgt die Schwerkraft
hier etwa gleichviel – obwohl diese Welt etwa das
dreißigfache Volumen hat ... Die Primitivisten moch-
ten den Großen Planeten. Es war ein Paradies – son-
nig, hell, ein mildes Klima – und vor allem mit orga-
nischen Verbindungen, die denen der Erde ähnlich
waren. Mit anderen Worten, die auf dem Großen Pla-
neten vorkommenden Proteine waren nicht unver-
träglich mit irdischem Protoplasma. Sie konnten die
Pflanzen und die Tiere essen. Sie ließen sich hier nie-
der, während ein paar von ihnen zur Erde zurück-
kehrten, um Freunde nachzuholen.«
»Es war Platz genug für Minderheiten – endlos viel
Platz. Und so zogen sie los – all die Kulte, misanthro-
pische Gesellschaften, Leute überhaupt. Manchmal
errichteten sie Siedlungen, manchmal lebten sie für
sich selbst – tausend, zweitausend oder fünftausend
Meilen vom nächsten Nachbarn entfernt. Verwertba-
re Erzvorräte gab es auf dem Großen Planeten nicht;
die technische Zivilisation bekam nie eine Chance,
und die Erde weigerte sich, moderne Waffen auf den
Großen Planeten zu exportieren. So entwickelte sich
der Große Planet zu einer Ansammlung von kleinen
Staaten und Städten, zwischen denen sich weite, leere
Landstriche dahinziehen.«

Nancy wollte etwas sagen, aber Glystra kam ihr
zuvor. »Ja, wir hätten eine einheitliche Regierung für
den Großen Planeten organisieren und ein einheitli-
ches Gesetz als gültig erklären können. Aber erst
einmal befindet sich diese Welt außerhalb der aner-
kannten Grenzen des Systems. Zweitens würden wir
dabei über die Absicht jener Leute hinweggehen, die
ihren Platz in einer der zivilisierten Welten aufgege-
ben haben, um ihre Unabhängigkeit zu gewinnen –
was durchaus zu respektieren ist. Drittens würden
wir damit weiteren ruhelosen Seelen diese Zuflucht
verweigern, was nur zur Folge hätte, daß sie noch
weiter draußen nach anderen Welten suchen würden,
die ihnen wahrscheinlich weit schlechtere Vorausset-
zungen böten. Also haben wir den Großen Planeten
quasi zur Rubrik ›Verschiedenes‹ innerhalb des Sy-
stems werden lassen. Wir haben die Erdenklave mit
ihrer Universität und Handelsschule für diejenigen
eingerichtet, die zur Erde zurückkehren wollen. Aber
es bewerben sich nur wenige.«
»Natürlich nicht«, ereiferte sich Nancy. »Es ist ein
Ort des Wahnsinns.«
»Warum sagst du das?«
»Das ist bekannt. Ein Bajarnum von Beaujolais ist
einmal in die Enklave gegangen. Er hat dort die
Schule besucht und ist völlig verändert wieder zu-
rückgekommen. Er hat die Sklaven befreit und alle
körperlichen Strafen abgeschafft. Als er das Landeig-
nersystem aufheben wollte, stellte sich der Rat der
Herzöge gegen ihn. Sie brachten ihn um, weil er of-
fensichtlich verrückt war.«
Claude Glystra lächelte dünn. »Er war der ver-
nünftigste Mensch auf dieser ganzen Welt ...«

Sie schnaufte verächtlich.
»Ja«, sagte Glystra. »Nur wenige kommen zur En-
klave. Der Große Planet ist ihre Heimat. Er bedeutet
Freiheit – offenes Land – keine Grenzen. Ein Mensch
kann sich die Art von Leben wählen, die er vorzieht,
obwohl er in jeder Minute Gefahr läuft, getötet zu
werden. Auf der Erde und den anderen Planeten des
Systems haben wir eine straff regierte Gesellschaft
mit starren Konventionen. Es läuft alles glatt und rei-
bungslos jetzt; die meisten Außenseiter sind mittler-
weile auf dem Großen Planeten gelandet.«
»Ich stelle mir das langweilig vor«, sagte Nancy.
»Stupide und langweilig.«
»Das stimmt nicht ganz«, sagte Glystra. »Schließ-
lich leben fünf Milliarden Menschen auf der Erde,
und nicht zwei von ihnen sind völlig identisch.«
Nancy schwieg einen Augenblick lang, dann fragte
sie fast ebenso vorwurfsvoll weiter: »Und was ist mit
dem Bajarnum von Beaujolais? Er hat vor, den Pla-
neten zu erobern. Es ist ihm bereits gelungen, das
Territorium von Beaujolais um das Dreifache auszu-
weiten.«
Glystra sah geradeaus nach unten, in die grenzen-
lose Nacht des Großen Planeten. »Wenn der Bajar-
num von Beaujolais, der Nomarch von Skene, der Ba-
ron von Gaypride, die Neun Zauberer oder sonst ir-
gend jemand den Großen Planeten dominiert, dann
haben die Bewohner des Großen Planeten ihre Frei-
heit und Beweglichkeit mit noch größerer Sicherheit
verloren, als wenn das System eine Bundesregierung
organisierte. Weil sie dann gezwungen würden, ihr
Leben an abweichende Vorstellungen anzupassen,
die nicht ihre eigenen sind, und nicht nur an ein paar

Gesetze und Regelungen, die im wesentlichen aus
vernünftigen Gründen aufgestellt wurden.«
Sie war damit noch nicht überzeugt. »Ich bin über-
rascht, daß das System den Bajarnum für wichtig ge-
nug befand, sich um ihn zu kümmern.«
»Schon die Tatsache, daß wir hier sind, sagt dir et-
was über den Bajarnum. Er hat Spione und Agenten
überall – auch auf der Erde. Er übertritt regelmäßig
unser Gesetz Nummer eins: das Waffen- und Metal-
lembargo für den Großen Planeten.«
»Ein Mann kann mit einem Birkenholzschwert
ebenso getötet werden wie mit einem Lichtstrahl.«
Glystra schüttelte den Kopf. »Dabei berücksichtigst
du nur einen Aspekt der Sache. Woher kommen diese
Waffen? Das System verbietet die nichtlizensierte
Herstellung von Waffen. Es ist sehr schwierig, im ge-
heimen eine moderne Herstellungsanlage zu errich-
ten, daher sind die Waffen entweder gestohlen oder
durch Piraterie aufgebracht worden. Schiffe und De-
pots werden aufgesprengt, Männer getötet oder zu
Sklaven gemacht und in die Ein-Mann-Königreiche
verfrachtet.«
»Ein-Mann-Königreiche? Was heißt das?«
»Unter den fünf Milliarden Bewohnern der Erde,
die ich vorhin erwähnte, gibt es ein paar recht seltsa-
me Typen«, erklärte Glystra gedankenvoll. »Nicht
alle seltsamen Käuze sind zum Großen Piraten abge-
wandert. Wir haben überreiche und überreife Kreatu-
ren auf der Erde, von denen viele eine kleine Welt ir-
gendwo außerhalb des Systems gefunden haben, wo
selbst sie sich zum Monarchen erkürt haben. Die Pi-
raten verkaufen ihnen Sklaven, und in ihren kleinen
Königreichen ist ihr Wille Gesetz. Nach zwei oder
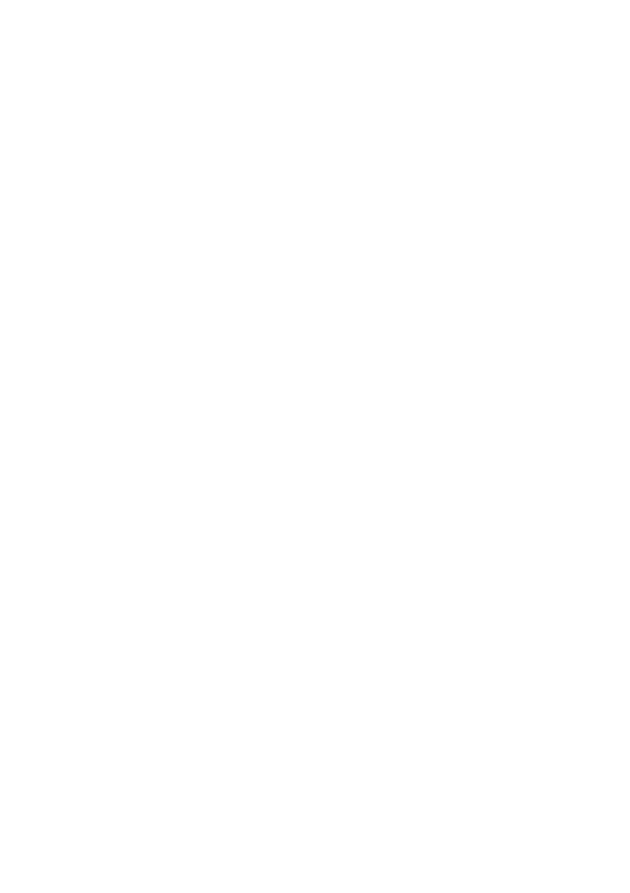
drei Monaten kehren sie ins System zurück und füh-
ren sich eine Zeitlang als gute Bürger auf. Wenn sie
der Kosmopolis überdrüssig sind, dann geht es zu-
rück in ihr Ein-Mann-Königreich, draußen zwischen
den Sternen.«

4
Nancy schwieg. »Was hat das mit Charley Lysidder
zu tun?« fragte sie dann.
Glystra sah sie von der Seite her an; er konnte ihr
Gesicht nur als weiße Maske in der Dunkelheit er-
kennen. »Wie kann der Bajarnum für seine von der
Erde nach hier geschmuggelten Waffen bezahlen? Sie
sind teuer. Eine Menge Blut wird vergossen für jeden
Ionenstrahler.«
»Ich weiß nicht ... daran habe ich nie gedacht.«
»Es gibt kein Metall auf dem Großen Planeten, aber
es gibt Handelsgüter, die weit kostbarer sind.«
Nancy sagte nichts.
»Menschen.«
»Oh ...«
»Charley Lysidder ist wie der Überträger einer
Seuche, und er infiziert das halbe Universum.«
»Aber – was ist dagegen schon zu unternehmen?
Ihr seid nur acht Männer. Ihr habt keine Waffen, kei-
ne Pläne, keine Dokumente ...«
»Nur unsere Gehirne.«
Nancy verfiel in ein Schweigen, das Glystra veran-
laßte, ihr einen irritierten Blick zuzuwerfen. »Das
scheint dich nicht zu beeindrucken?«
»Ich ... ich bin sehr unerfahren.«
Claude Glystra versuchte erneut, ihr Gesicht durch
die Dunkelheit hindurch zu mustern; diesmal, um
festzustellen, ob sie tatsächlich ernst meinte, was sie
sagte. »Wir bilden ein Team. Jeder von uns ist ein
Spezialist. Pianza hier« – er nickte in Richtung auf
den grauen Schatten zu seiner Linken – »ist ein Orga-

nisator und Verwalter. Moss Ketch zeichnet unsere
Erkundungen mit Kamera und Sonographen auf.
Bruce Darrot ist ein Ökologe –«
»Was ist das?«
Glystra sah nach vorn, wo Fayne und Darrot gin-
gen, und lauschte auf ihre dumpfen Schritte. Sie ka-
men jetzt in ein Gebiet, das mit vereinzelten großen
Bäumen bestanden war; vor ihnen ragten die Wälder
von Tsalombar auf, deren Silhouette noch dunkler
war als der nachtschwarze Himmel. »Ökologie«,
setzte Glystra an, »beschäftigt sich letztlich damit,
wie man die Leute satt macht. Hungrige Menschen
sind oft zornig und gefährlich.«
Mit unterdrückter Stimme sagte Nancy: »Die Zi-
geuner sind immer hungrig ... Sie haben meinen Va-
ter umgebracht ...«
»Sie haben ihn nicht getötet, weil sie hungrig waren
– ein toter Mann nützt Sklavenhaltern wenig. Sie ha-
ben
vielmehr versucht, ihn lebendig zu bekommen ...«
»Nun, um fortzufahren, Fayne ist unser Mineralo-
ge. Ich bin der Koordinator und Propagandist.« Bevor
sie dazukam, fragte er: »Warum kann der Bajarnum
seine Nachbarn besiegen?«
»Weil er die stärkere Armee hat ... Er ist sehr geris-
sen.«
»Angenommen, seine Armee verweigerte ihm den
Gehorsam. Angenommen, niemand kümmerte sich
um seine Befehle. Was könnte er dann noch unter-
nehmen?«
»Nichts. Er wäre machtlos.«
»Propaganda, die im höchsten Maße wirksam ist,
erreicht genau das. Ich arbeite mit Bishop zusammen.
Bishops Gebiet ist die Kultur – die menschliche Ge-

sellschaft. Wenn man ihm eine Pfeilspitze zeigt, dann
kann er dir sagen, ob der Mann, der sie gemacht hat,
seinen Namen von seinem Vater oder von seiner
Mutter bekommen hat. Aus dem kulturellen Hinter-
grund eines Volkes kann er dessen Besonderheiten,
dessen kollektive Motivationen entnehmen – die Vor-
stellungen, aufgrund derer sie reagieren wie eine
Herde von« – er wollte eben »Schafe« sagen, aber er
dachte noch rechtzeitig daran, daß der Große Planet
eine solche Tierart nicht beherbergte – »wie eine Her-
de von Pelikanesen.«
Sie sah ihn mit einem leichten Lächeln an. »Und du
kannst die Leute dazu bringen, daß sie sich wie Peli-
kanesen verhalten?«
Glystra schüttelte den Kopf. »Ganz so ist es nicht.
Jedenfalls nicht immer.«
Sie gingen weiter hangabwärts. Die Bäume standen
zunehmend dichter; sie hatten die Wälder von Tsa-
lombar erreicht. Vor, hinter und neben ihm mar-
schierten acht dunkle Schatten. Schwer atmend sagte
er zu Nancy: »Einer von ihnen – ich weiß nicht, wer –
ist mein Feind. Ich muß irgendwie herausfinden, wer
es ist ...«
Sie hatte zu atmen aufgehört. »Bist du sicher?«
fragte sie mit gedämpfter Stimme.
»Ja.«
»Was wird er unternehmen?«
»Wenn ich das wüßte, dann würde ich darauf ach-
ten.«
»Der Zauberbrunnen am Myrtensee könnte es dir
sagen. Er weiß alles.«
Glystra kramte in seinen Erinnerungen. »Wo ist der
Myrtensee?«

Sie gestikulierte. »Weit im Osten. Ich war noch nie
dort; es ist eine gefährliche Reise, wenn man nicht die
Monobahn benutzt, und die kostet viel Metall. Mein
Vater hat mir von dem Orakel beim Brunnen erzählt.
Das Orakel spricht wie im Fieber und beantwortet
alle Fragen. Schließlich stirbt es, und die Dongmän-
ner erwählen ein neues Orakel.«
Fayne und Darrot, die vor ihnen gingen, hielten ab-
rupt inne. »Still!« wisperte Darrot. »Vor uns ist ein
Lager mit Feuerstellen.«
Die ächzenden und sich wiegenden Äste der Tsa-
lombar-Wälder bedeckten den Himmel, und die
Dunkelheit war fast vollkommen. Vor ihnen flicker-
ten ein paar rote Funken durch die Baumstämme zu
ihnen durch.
»Sollten das die Baummenschen sein?« wandte sich
Glystra an Nancy.
Sie gab skeptisch zurück: »Nein ... Sie kommen
niemals von den Bäumen herab. Und sie fürchten sich
vor dem Feuer wie vor dem Tod ...«
»Eng aufschließen«, sagte Glystra. Dunkle Schatten
traten heran.
»Ich werde vorausgehen, um die Lage zu erkun-
den«, sagte Glystra mit tiefer, gepreßter Stimme.
»Bleibt alle dicht beisammen. Das ist sehr wichtig.
Niemand soll sich von der Gruppe wegbewegen oder
einen Ton von sich geben, bevor ich wieder zurück-
kehre. Nancy, du stehst in der Mitte; die anderen ste-
hen so um sie herum, daß sie sich mit den Ellbogen
berühren. Achtet darauf, wer sich neben euch befin-
det und daß er sich nicht bewegt.«
Er ging um die Gruppe herum. »Ist jeder mit zwei
anderen in Berührung? Gut. Abzählen.« Einer nach

dem anderen sagte tonlos seinen Namen.
»Ich komme so schnell wie möglich wieder zu-
rück«, versprach Glystra. »Wenn ich Hilfe brauche –
dann werde ich schreien. Also haltet die Ohren of-
fen.«
Das Farnkraut raschelte unter seinen Füßen, wäh-
rend er sich langsam weiter abwärts bewegte.
Es war ein großes Feuer, das von Holzblöcken ge-
nährt wurde und inmitten einer Lichtung hoch auf-
flammte. Fünfzig oder sechzig Männer hatten sich
darum herum niedergelassen. Ihre blauen Uniformen
bestanden aus weiten Hosen, die unterhalb der Knie
aufgewunden waren, und Kitteln, die an der Hüfte
von einer schwarzen Schärpe zusammengefaßt wur-
den. Auf der Brust trugen sie ein rotes Insignium, ein
auf der Spitze stehendes Dreieck. Sie trugen Messer
und Schleudern in ihren Schärpen; mit Pfeilen ge-
füllte Köcher waren am Rücken befestigt.
Es war ein rauher Haufen – sie waren kurz und
untersetzt, mit gleichförmigen, dunklen Gesichtern,
kleinen Spitzbärten, engen Augenschlitzen und ge-
krümmten Nasen. Sie tranken aus schwarzen, nieren-
förmigen Lederbeuteln. Die Disziplin war im Augen-
blick ziemlich nachlässig.
Ein wenig entfernt, der lärmenden Szenerie seinen
Rücken zugewandt, stand ein Mann in einer schwar-
zen Uniform. Glystra sah, daß es Abbigens war. Ab-
bigens unterhielt sich mit einem Mann, der offenbar
der befehlshabende Offizier war. Der Offizier hörte
ihm zu und nickte; es sah aus, als erhielte er Anwei-
sungen von Abbigens.
Unweit von Glystra verharrte ruhelos ein Zug von
äußerst merkwürdigen Tieren. Sie schwangen ihre

langen Hälse hin und her, schnappten in die Luft,
murrten und krächzten. Sie waren schmal in den
Schultern und hatten einen hohen Rücken; außerdem
verfügten sie über sechs mächtige Beine und einen
schmalen, wenig vertrauenseinflößenden Kopf – ein
Mischung aus Kamel, Pferd, Ziege, Hund und Echse.
Der Gepäckträger hatte sich nicht die Mühe gemacht,
ihnen das Gepäck abzunehmen. Glystras Interesse
war erwacht; vorsichtig untersuchte er die Lasten, die
sie trugen.
Eines der drei Tiere trug drei Metallzylinder, ein
anderes einen flachen Lauf und ein Bündel von Me-
tallstäben. Glystra erkannte, worum es sich handelte:
eine Ionenkanone von einem Kaliber, mit dem sich
eine Ortschaft wie Jubilith dem Erdboden gleichma-
chen ließ. Das Gerät war eindeutig irdischer Her-
kunft. Glystra sah sich unbehaglich um. Es war ei-
gentlich seltsam, daß keine Wachen postiert worden
waren.
Eine ungewohnte Geschäftigkeit am anderen Ende
der Lichtung erregte seine Aufmerksamkeit. Etwa ein
Dutzend Soldaten starrten, den Kopf in den Nacken
gelegt, nach oben, deuteten auf etwas, sprachen er-
regt miteinander. Glystra folgte ihren Blicken. Etwa
dreißig Meter über ihnen war ein Dorf – ein Netz aus
einfachen Brücken, begehbares Geflecht, an Lianen
festgespannt, und entsprechende Hütten, freischwin-
gend wie Goldamselnester. Kein Licht war zu sehen,
die Baumhütten lagen im Dunkeln, aber seitlich über
die Brücken hinweg starrten einige Dutzend weiße
Gesichter, umrahmt von einem Gewirr brauner Haa-
re. Sie machten keine Geräusche, bewegten sich
kaum, und wenn, dann so abrupt und schnell wie

Eichhörnchen. Die Soldaten von Beaujolais hatten das
Dorf offenbar zuvor noch nicht bemerkt. Glystra sah
erneut hoch. Sie hatten ein Mädchen entdeckt – käse-
gesichtig und triefäugig, aber immerhin ein Mädchen.
Glystra sah interessiert zu den Packtieren hin, ver-
suchte die Chancen abzuschätzen, sie in den Wald zu
entführen, während die allgemeine Aufmerksamkeit
durch das Mädchen im Baumdorf abgelenkt war. Er
befand, daß die Chancen zu gering waren.
Am anderen Ende der Lichtung entstand erneute
Aktivität. Ein junger Großtuer mit einem gezwirbel-
ten Bart kletterte eine grobe Leiter hoch, die zu der
Hütte führte, aus der der Mädchenkopf herausragte.
Der Weg nach oben war leicht; zwischen den Ästen,
an denen man sich hochziehen konnte, waren Stufen
in das Holz geschlagen. Der Soldat, von den Zurufen
seiner Kameraden angefeuert, kletterte den Stamm
entlang hoch und hielt auf einer groben Plattform in-
ne. Er war hier bereits teilweise von Gezweig und
Blattwerk verdeckt. Eine Bewegung, ein Geräusch
wie beim Abrutschen eines Körpers, das Aufschlagen
von Holz auf Holz, raschelndes Blattwerk, knacken-
des Gezweig. Ein um sich schlagender, sich drehen-
der Körper fiel aus den Schatten heraus und landete
mit einem schweren Aufschlag auf dem Boden.
Glystra sprang erschrocken zurück. Er sah in die
Höhe; im Baumdorf bewegte sich nichts. Der Soldat
war offenbar in eine Falle geraten. Ein schräg dar-
überhängendes Gewicht war herabgefallen und hatte
ihn von der Plattform gefegt. Jetzt lag er jammernd
auf dem Boden. Seine Kameraden standen um ihn
herum und sahen ihn an, ohne sichtlich bewegt zu
sein. Sie sahen ab und zu zu den Baummenschen hin-

auf, aber ohne erkennbare Feindseligkeit.
Abbigens und der Offizier gingen hinüber und sa-
hen auf den gestürzten Mann hinab. Er hielt seine
Seufzer zurück, lag reglos da und sah mit bleichem
Gesicht hinauf. Der Offizier sagte etwas; Glystra
konnte seine Stimme hören, aber nicht die Worte un-
terscheiden. Der auf dem Boden liegende Soldat gab
eine Antwort; er versuchte sich zu erheben, doch das
war eine vergebliche Anstrengung. Eines seiner Beine
stand in einem merkwürdigen Winkel von ihm weg;
mit verzerrtem Gesicht, die Zähne aufeinandergebis-
sen, fiel er wieder zurück.
Der Offizier sagte etwas zu Abbigens; Abbigens
antwortete, während er zugleich in Richtung auf das
Baumdorf gestikulierte. Der Offizier gab einem der
Soldaten etwas durch eine Bewegung zu verstehen,
wandte sich dann ab.
Der Soldat sah auf seinen am Boden liegenden Ka-
meraden hinab, gab murmelnd seinem Bedauern
Ausdruck. Dann zog er sein Schwert aus der Scheide
und erschlug den Gestürzten.
Glystra, hinter einem Baum in Deckung, schluckte
den Kloß hinunter, der in seinem Hals gesteckt hatte.
Der Offizier ging kreuz und quer durch das Lager
und bellte Befehle. Diesmal waren die Worte deutlich
genug, daß Glystra sie verstehen konnte: »Los, los,
auf die Füße. Reihen bilden, aber noch mal so schnell,
wir sind schon zu lange hier. Gepäckführer, die Tiere
bereithalten –«
Abbigens kam heran und sprach kurz mit dem Of-
fizier. Der Offizier nickte, ging quer über die Lich-
tung. Glystra konnte seine Befehle nicht hören, aber
der Soldat, der für die Gepäcktiere zuständig war,

führte die zwei Tiere mit der Ionenkanone zur Seite.
Claude Glystra beobachtete es mit schmalen Au-
gen. Sollte die Ionenkanone gegen das Baumdorf ein-
gesetzt werden?
Die Ionenkanone wurde zusammengebaut und auf
ihrem Dreifuß befestigt. Das Licht des Feuers wurde
widergespiegelt durch den glatten metallenen Lauf.
Der Richtschütze zog den Lauf vor und zurück, be-
wegte, ihn auf und ab, um die Balance zu prüfen. Er
entsicherte, justierte die Mündung und betätigte den
Abzug. Ein Strahl violetten Lichtes entfloh der Mün-
dung, Energien zuckten die schmale Bahn ionisierter
Luft entlang und fraßen sich in den Boden hinein.
Test abgeschlossen. Die Waffe war bereit.
Der Richtschütze legte die Sicherung wieder an,
ging zu den Gepäcktieren zurück und wählte das
stärkste von ihnen aus. Er zog an den Gurten, die das
Gepäck auf dem Rücken des Tieres hielten. Der Ge-
päckführer kam wütend heran, und die beiden Män-
ner gerieten in einen Disput.
Glystra setzte sich in Bewegung, zögerte, nahm er-
neut Anlauf, fiel wieder zurück. Wütend sammelte er
seinen Mut. Dies war die Zeit der Tapferkeit, in der
alles auf eine Kappe gesetzt werden mußte. Er trat
vor und wagte sich in das Licht des Feuers. Er
schwang die Waffe herum, justierte die Mündung zu
einem schmalen Strahl, entsicherte. Es war geradezu
lächerlich einfach.
Einer der Soldaten stieß einen Schrei aus, deutete
auf ihn.
»Keine Bewegung!« rief Glystra mit lauter Stimme.

5
Die Umrisse auf der Lichtung erstarrten, überraschte
Gesichter wandten sich in seine Richtung. Der Kano-
nier sprang mit einem wütenden Aufschrei nach
vorn. Claude Glystra betätigte den Abzug, der
Leitstrahl violetten Lichts flammte auf, Energien
zuckten durch die ionisierte Luft. Der Kanonier wur-
de voll getroffen, und mit ihm gingen fünf weitere
Männer im Kanonenstrahl dahin.
Glystra
rief
mit erhobener Stimme: »Pianza! Fayne!«
Keiner der Soldaten bewegte sich mehr. Abbigens
starrte ihn mit ausdruckslosem, bleichem Gesicht an.
Hinter ihm kamen Schritte auf. »Wer ist es?« fragte
Glystra.
»Eli Pianza – und die anderen von uns.«
»Gut. Geht um mich herum zur Seite, wo ihr außer
Reichweite seid.« Er hob seine Stimme. »Jetzt kommt
ihr dran, Schergen von Beaujolais. Ihr geht zur Mitte
hin, auf dieser Seite des Feuers. Schnell!«
Mürrisch folgten die Soldaten von Beaujolais seiner
Anweisung. Abbigens ging drei schnelle Schritte mit
ihnen mit, aber Glystras Stimme brachte ihn zum In-
nehalten. »Abbigens – leg deine Hände auf deinen
Kopf und bewege dich rückwärts auf mich zu. Ein
bißchen schneller ...«
Zu Pianza gewandt, sagte er: »Nimm seine Waffe.«
Er wies auf den Offizier, der sich in der Gruppe sei-
ner Soldaten langsam in den Hintergrund schob. »Sie
– treten Sie vor, die Hände auf dem Kopf.« Und aus
dem Mundwinkel heraus: »Einer von euch soll ihn
untersuchen – Elton!«

Elton trat vor: Vallusser schien ihm folgen zu wol-
len. Glystra schnappte: »Ihr anderen bleibt, wo ihr
seid ... die Sache ist kitzlig.«
Abbigens trug einen Ionenstrahler; der Offizier
hatte eine Raketenpistole bei sich.
»Legt die Waffen auf den Boden«, befahl Glystra,
»und fesselt sie mit den Gepäckgurten.«
Abbigens und der Offizier lagen hilflos da. Die
Soldaten standen mürrisch und leise miteinander
murmelnd im Mittelpunkt der Lichtung.
»Nancy!« rief Glystra.
»Ja.«
»Tu genau, was ich dir sage. Nimm diese beiden
Waffen – an ihren Läufen. Bring sie zu mir her. Begib
dich nicht in die Schußlinie zwischen mir und den
Soldaten.«
Nancy ging auf die Stelle in der Lichtung zu, an der
die Waffen am Boden aufblitzten.
»Am Lauf!« sagte Glystra schneidend.
Sie zögerte, sah ihn mit großen Augen an, die Haut
unterhalb der Wangenknochen angespannt und
bleich. Glystra sah ihr mit steinerner Miene zu. In
diesem Augenblick konnte er niemandem vertrauen.
Sie beugte sich hinab, nahm die Waffen vorsichtig auf
und brachte sie ihm. Er steckte sie ein, sah kühl beob-
achtend in die Gesichter seiner Begleiter. Hinter ei-
nem dieser Gesichter wurden wilde und verzweifelte
Pläne gewälzt ... Hinter welchem Gesicht?
Jetzt war der kritische Augenblick gekommen. Wer
immer es war, würde versuchen, hinter ihn zu gelan-
gen.
Er gestikulierte. »Ich möchte, daß ihr euch alle da
drüben seitlich hinstellt.« Er wartete, bis seine Be-

gleiter dieser Aufforderung nachgekommen waren.
»Und jetzt«, rief er den Soldaten zu, »kommt einer
von euch nach dem anderen über die Lichtung ...«
Eine halbe Stunde später hockten die Soldaten in ei-
nem engen Kreis zusammen, alle nach innen ge-
wandt, mit ausdruckslosen, leeren Gesichtern. Abbi-
gens und der Offizier lagen dort, wo sie gefesselt
worden waren. Abbigens sah Glystra an, ohne etwas
von seinen Gedanken zu verraten. Claude Glystra
wiederum beobachtete Abbigens, um festzustellen,
wem seine Blicke galten.
Eli Pianza sah skeptisch zu der Ansammlung von
Gefangenen hin. »Die werden uns noch Schwierig-
keiten bereiten ... was hast du mit ihnen vor?«
Glystra, der hinter der Kanone stand, entspannte
sich ein wenig, streckte sich. »Nun – freilassen kön-
nen wir sie nicht. Wenn die Nachricht von diesem
Vorfall nicht zum Bajarnum gelangt, dann haben wir
einen ziemlichen Vorsprung.« Sie sahen zu den Ge-
fangenen hinüber; über den zerknitterten blauen Uni-
formen spiegelten furchtsame Augen den Schein des
Feuers wider. »Wir haben also zu wählen, ob wir sie
umbringen oder sie mitnehmen.«
»Sie mitnehmen?«
»Ein paar Meilen weiter abwärts beginnt die Step-
pe. Das Land der Nomaden. Wenn es da etwas zu
kämpfen gibt, dann können wir sie vielleicht dazu
überreden, es für uns zu tun.«
»Aber – wir haben die Kanone. Wir brauchen keine
Schwerter und keine Pfeile.«
»Was nützt uns eine Ionenwaffe, wenn wir in einen
Hinterhalt geraten? Wenn wir von zwei oder drei

Seiten gleichzeitig angesprungen werden? Die Ionen-
kanone ist eine vorzügliche Waffe, wenn man sein
Ziel sehen kann.«
»Es dürfte etwas schwierig sein, mit ihnen zurecht-
zukommen.«
»Daran habe ich gedacht. Solange wir uns im Wald
befinden, bleiben sie zusammengebunden. Wenn wir
in die Steppe hinauskommen, können sie vor der Ka-
none herlaufen. Wir werden natürlich sehr aufpassen
müssen.«
Er sicherte die Ionenkanone, senkte den Lauf in
Richtung auf den Boden, ging dann zu der Stelle hin-
über, an der Abbigens lag. »Mir scheint, die Zeit des
Redens ist gekommen.«
Abbigens zog eine Grimasse. »Natürlich werde ich
reden. Aber was?«
Glystra setzte ein dünnes Lächeln auf. »Wer hat dir
an Bord der Vittorio geholfen?«
Abbigens Augen schweiften über die Gesichter
hinweg. »Pianza«, sagte er.
Eli Pianza hob überrascht seine weißen Augen-
brauen an. In irgendeinem der anderen Gesichter
kam etwas zum Ausdruck – wie ein kurzes Aufflak-
kern.
Glystra wandte sich abrupt ab. Im Augenblick gab
es nur eine Person, deren er sicher sein konnte – er
selbst.
Er deutete auf Darrot und Elton. »Ihr beide geht an
die Kanone. Keiner vertraut dem anderen. Ein Feind
ist unter uns. Wir wissen nicht, wer es ist, und wir
dürfen ihm nicht die Gelegenheit geben, uns alle zu
vernichten.« Er ging einen Schritt zurück, hielt seinen
Ionenstrahler bereit. »Ich werde alle Waffen an mich

nehmen. Pianza, du hast einen Ionenstrahler?«
»Ja.«
»Dreh mir den Rücken zu und leg ihn auf den Bo-
den.«
Pianza führte das ohne Widerrede aus. Claude
Glystra trat vor, tastete mit einer Hand Pianzas Kör-
per ab und faßte in seine Taschen. Er fand keine wei-
tere Waffe.
In ähnlicher Weise nahm er Faynes Ionenstrahler
und das Hitzegewehr von Ketch an sich. Vallusser
und Bishop trugen lediglich Messer bei sich. Nancy
verfügte über keinerlei Waffe.
Er steckte die Waffen ein, trat hinter die Kanone
und nahm auch noch Eltons Waffe an sich. Das
machte nun fünf Ionenstrahler, den von Abbigens
und den Hitzestrahler des Maates mitgezählt.
»Jetzt sind wir so waffenlos wie möglich, und ich
glaube, wir sollten jetzt schlafen. Ketch, du und Val-
lusser, ihr nehmt Schwerter und stellt euch jeweils
auf eine Seite der Lichtung; ungefähr so, daß ihr mit
der Kanone zusammen ein Dreieck bildet. Ihr solltet
auf keinen Fall zwischen die Kanone und die Solda-
ten geraten – denn wenn etwas geschieht, ist es um
euch geschehen.« Er wandte sich an Darrot und El-
ton. »Habt ihr das gehört? Benutzt die Kanone, wenn
ihr auch nur die kleinste Entschuldigung dafür habt.«
»In Ordnung«, sagte Elton. Darrot nickte.
Er sah Nancy, Pianza und Bishop an. »Wir werden
die zweite Wache übernehmen ... dort beim Feuer ist
ein guter Platz, der außerhalb der Reichweite der Ka-
none ist.«
Der farnbewachsene Boden, von der Feuerstelle
erwärmt, erwies sich als weich und angenehm.

Glystra ließ sich nieder, und die lange entbehrte Ent-
spannung hätte ihn fast augenblicklich eindösen las-
sen.
Seine Gedanken schweiften ab, während er ent-
spannt dalag, die Hände unter den Kopf gelegt. Von
den Hängebrücken über ihm schauten noch immer
die weißen Flecken herab; und er hatte den sicheren
Eindruck, daß sie sich noch nicht einmal bewegt hat-
ten, seit er sie zum erstenmal gesehen hatte.
Steve Bishop ließ sich nahe ihm nieder und seufzte.
Glystra sah mit einem leichten Bedauern zu ihm hin-
über. Bishop war Student und etwas heikel, auch oh-
ne das Bedürfnis, sich eine etwas rauhere Außenhaut
zuzulegen ... Nancy kehrte aus dem Wald zurück.
Glystra hatte augenblicklichen Verdacht geschöpft,
wie er sie hatte gehen sehen, sich dann aber gesagt,
daß es einfach unmöglich war, jeden Augenblick des
Wachseins einen jeden zu überwachen. Und am
nächsten Morgen würde er sie ohnehin nach Jubilith
zurückschicken.
Es gab keine Geräusche auf der Lichtung, abgese-
hen von dem tiefen Gemurmel, das von den zusam-
men am Boden kauernden Soldaten her kam. Darrot
und Elton standen steif hinter dem Ionengeschütz.
Ketch ging langsam die eine Seite der Lichtung auf
und ab, Vallusser die andere. Hinter ihm lag Nancy,
ruhig und warm; Bishop schlief wie ein Baby, wäh-
rend sich Pianza unruhig hin- und herwarf.
Die Spannung wuchs, und Glystra versuchte, die
objektive Ursache dafür zu ergründen. Lag es an El-
tons angespannter Wachsamkeit, an Darrots unbeug-
samer Haltung? Oder daran, daß er Nancy in seinem
Rücken spürte? Eine kleine Unregelmäßigkeit in den

Atemzügen von Bishop oder Pianza? ... Er versuchte
zu erkennen, wen Abbigens beobachtete, doch verge-
bens.
Die Minuten gingen vorbei, eine Viertelstunde, eine
halbe Stunde. Die Luft war spröde wie Eis.
Moss Ketch ging ein paar Schritte in Richtung auf
das Geschütz; er gestikulierte, murmelte ein paar
Worte und zog sich dann in den Wald zurück. In die
Reihen der Soldaten kam ein wenig Bewegung. Ein
kurzer Anruf von Darrot ließ sie zur Bewegungslo-
sigkeit erstarren.
Ketch kehrte zurück, und Vallusser ging in den
Wald. Wieder die Unruhe unter den Soldaten, ein
einsilbiger Laut von Darrot, und erneute Bewe-
gungslosigkeit.
Da war ein plötzlicher schattenhafter Umriß hinter
der Kanone, das Singen eines zustoßenden Schwertes,
ein überraschter Schrei, der unsagbare Schmerzen
verriet ... Dann ein Aufschlagen von Füßen, Klirren
von Metall.
Die Zähne aufeinandergepreßt, sprang Claude
Glystra auf seine Füße. Gleichzeitig riß er den Ionen-
strahler hoch.
Am Geschütz stand jetzt nur noch ein Mann, der
sich damit mühte, den Lauf auf Glystra zu richten.
Glystra sah, wie die Mündung auf ihn zuschwenkte,
wie sich die Ellbogen anspannten ... Er drückte den
Abzug seines Ionenstrahlers durch. Knisternde Ener-
gien zuckten an einem violetten Strahl entlang. Der
Kopf des Mannes wurde verkohlt und schrumpfte
zusammen; die Kanone wurde zerschmolzen und zur
Seite geschleudert. Glystra sprang herum, stellte sich
den Soldaten entgegen. Sie hatten sich erhoben und

standen wie erstarrt, unentschieden, ob sie angreifen
oder fliehen sollten.
»Setzen!« sagte Glystra mit schneidender, tödlicher
Stimme. Die Soldaten gingen augenblicklich wieder
zu Boden.
Glystra langte in den Tragbeutel, den er umge-
hängt hatte, und warf Pianza und Bishop Waffen zu.
»Paßt von hier aus auf sie auf; wir haben kein Ge-
schütz mehr.«
Er ging zu dem zerstörten Feldgeschütz hinüber
und erkannte drei Körper. Elton lebte noch. Bruce
Darrot lag daneben, das leblose Gesicht nach oben
gerichtet, in verkrampfter Abwehr über den Tod hin-
aus. Vallussers Körper lag quer über Darrots Füßen.
Glystra sah auf ihn hinab. »Also war es Vallusser.
Ich frage mich nur, womit sie ihn gekauft haben.«
Moss Ketch hatte den Erste-Hilfe-Behälter ausge-
packt, und sie knieten neben Elton. Ein Schwerthieb
hatte seitlich neben seinem Nacken eine stark bluten-
de Schnittwunde hinterlassen. Glystra wandte ein
Gerinnungsmittel an, dann ein Antiseptikum, und
sprühte einen elastischen Film über die Wunde.
Er erhob sich und sah auf Abbigens hinab. »Jetzt
kannst du uns nicht mehr von Nutzen sein. Ich weiß
jetzt, was ich wissen wollte.«
Abbigens schüttelte das dichte blonde Haar aus
seinem Gesicht. »Ihr werdet mich doch nicht etwa –
umbringen?«
»Warte ab, und du wirst es sehen«, erklärte Glystra
und wandte sich ab. Er sah auf seine Uhr. »Zwölf
Uhr.« Er warf Eltons Ionenstrahler Ketch zu und
wandte sich an Pianza und Bishop. »Ihr beide schlaft
jetzt; wir halten Wache bis um drei.«

6
Darrot und Vallusser wurden zusammen mit den
Toten aus Beaujolais in einem Grab begraben: dem
jungen Angeber, der vom Baum gefallen war, und
den sechs Soldaten, die getötet worden waren, als
Glystra das Geschütz im Handstreich erobert hatte.
Abbigens seufzte vernehmbar auf, als Erde auf die
Körper zu fallen begann. Glystra grinste; Abbigens
hatte offensichtlich erwartet, mit den anderen Sieben
das Grab teilen zu müssen.
Glystra sah sich in der Lichtung um. Wo war Nan-
cy? Sie stand bei den Gepäcktieren und sah so un-
schuldig drein, wie sie nur konnte. Die Baumstämme
hinter ihr ragten empor wie die Säulen eines großen
Tempels, und zwischen ihnen schimmerte der son-
nenbeschienene Abhang durch.
Nancy spürte Glystras Blick, und sie sah ihn mit of-
fenen Augen an, ein hoffnungsvolles Lächeln auf ih-
ren Lippen. Glystra spürte, wie sein Herz klopfte. Er
sah weg. Elton sah ihn mit einem undeutbaren Aus-
druck an. Er preßte die Lippen aufeinander und ging
nach vorn. »Du solltest dich jetzt besser auf den Weg
machen – zurück nach Jubilith.«
Ihr Lächeln löste sich langsam auf; ihr Kinn sank
herab, ihre Augen wurden feucht. Offenbar die
Sinnlosigkeit irgendwelcher Einwände begreifend,
wandte sie sich wortlos ab und überquerte die Lich-
tung. Am Rand der Lichtung hielt sie inne und sah
über ihre Schulter zurück.
Claude Glystra sah schweigend zu.
Sie wandte sich endgültig ab. Er sah ihr ein paar

Augenblicke lang nach, wie sie zwischen den Bäumen
verschwand.
Eine halbe Stunde später setzte sich die
Marschtruppe in Bewegung. Die Soldaten von Beau-
jolais gingen in einer Reihe voraus, jeder an den
Mann vor und hinter sich durch Handgelenkfesseln
gebunden. Ihre Schwerte und Katapulte waren ihnen
belassen worden, aber die Pfeile befanden sich in
Tragebehältern auf einem der Packtiere.
Der Offizier führte die Reihe an; Abbigens war der
letzte. Dann kamen die Packtiere; Elton wurde auf ei-
ner Bahre getragen, die zwischen den beiden ersten
Tieren aufgehängt war. Er war wach und ganz bei
der Sache; ihm oblag es, das hintere Ende der
Marschreihe mit dem großen Hitzegewehr zu über-
wachen.
Das Dorf über ihnen war ebenfalls wach und sah
ihnen zu. Während sich die Reihe durch den Wald
bewegte, waren Schritte über ihnen zu vernehmen,
und die Hängebrücken ächzten in ihren Aufhängun-
gen. Manchmal waren auch unterdrückte Stimmen zu
hören, oder ein schreiendes Kind. Im Augenblick
schnitt ihnen eine Decke aus ineinander verwobenen,
zerfetzten Vegetationsstücken, gestützt durch ein
Flickwerk aus Ästen, Lianen und getrockneten gelben
Farnwedeln, das Sonnenlicht ab. Dieser zweite Wald-
boden dehnte sich überraschend weit aus, war an der
Unterseite feucht und verlor ständig kleine Stückchen
und Fetzen verrottender Vegetation.
»Was haltet ihr davon?« fragte Pianza.
»Für mich sieht das wie ein hängender Garten
aus«, gab Glystra zurück. »Wir haben leider keinen
Ökologen mehr zur Verfügung. Bruce hätte uns si-

cherlich etwas mehr darüber sagen können ...«
Helligkeit vor ihnen zeigte an, daß der hängende
Garten dort zu Ende war. Glystra ging nach vorn bis
zum Anfang der Reihe, wo der Offizier ging, den
Blick stur geradeaus gerichtet. »Wie ist Ihr Name?«
»Morwatz. Infanterieführer Zoriander Morwatz,
Hundertzwölfter an der Champs-Mars-Akademie.«
»Wie lauteten Ihre Befehle?«
Der Offizier zögerte, schien im Zweifel zu sein, ob
es richtig war, die Fragen zu beantworten. Er war
untersetzt, hatte ein rundliches Gesicht und vorste-
hende dunkle Augen. Seine Aussprache unterschied
sich ein wenig von der seiner Soldaten, und er konnte
auch nicht verbergen, welche Wichtigkeit er sich
selbst zumaß.
»Wie lauteten Ihre Befehle?«
»Wir wurden dem Kommando des Erdenmannes
unterstellt.« Er wies mit dem Kopf nach hinten, wo
Abbigens ging. »Er hatte einen versiegelten Brief von
Charley Lysidder, ein Instrument großer Autorität.«
Glystra mußte das einen Augenblick lang verdau-
en, fragte dann: »Einen Befehl, der direkt an Sie
adressiert war?«
»An den kommandierenden Offizier der Montmar-
chy-Garnison.«
»Hmmm.« Woher hatte Abbigens diesen Befehl er-
halten, der vom Bajarnum von Beaujolais unterzeich-
net war? Es gab da ein Muster, das Claude Glystra
noch nicht als Ganzes wahrzunehmen vermochte. Es
stand für ihn fest, daß die Tatsachen von Vallussers
Schuld nicht all die Ereignisse der letzten paar Wo-
chen erklärte.
Er stellte weitere Fragen und erfuhr, daß Morwatz

in die Guerdons hineingeboren worden war – eine
Kaste des niedrigen Adels – und darauf auch noch
stolz war. Er stammte aus der Ortschaft Pellisade, ein
paar Meilen südlich von Grosgarth gelegen, und er
glaubte fest daran, daß die Erde die Heimat einer
hirnlosen Roboterrasse war, die maschinengleich auf
Gongschläge und Klingelsignale reagierte. »Wir hier
in Beaujolais würden lieber sterben, als uns so ernied-
rigen zu lassen«, erklärte Morwatz mit einem leuch-
tenden Feuer in den Augen.
Hier war die genaue Entsprechung, überlegte
Glystra, zu dem auf der Erde verbreiteten Stereotyp
der halbverrückten, rücksichtslosen Geschöpfe, die
den Großen Planeten unsicher machten. Grinsend
fragte er: »Sehen wir vielleicht so aus, als ob wir des
freien Willens entbehrten?«
»Ihr seid die Elite. Hier in Beaujolais gibt es keine
solche Tyrannei, wie ihr sie auf der Erde erfahrt. Wir
wissen alles darüber, und zwar von Leuten, die es am
besten wissen.«
Er sah Glystra von der Seite an. »Warum lächeln
Sie darüber?«
Glystra lachte laut auf. »Naisuka. Der Grund, der
überhaupt kein Grund ist.«
»Sie benutzen ein Wort aus den höchsten Kreisen«,
sagte Morwatz unsicher. »Selbst ich würde nicht wa-
gen, es auszusprechen.«
»Nun denn.« Claude Glystra zog seine Augenbrau-
en zusammen. »Es ist euch nicht erlaubt, gewisse
Worte zu benutzen – aber ihr lebt auch nicht unter ei-
ner Tyrannei.«
»Genauso ist es. Wie es sein sollte.« Und dann
nahm Morwatz allen Mut zusammen, um selbst eine

Frage zu stellen. »Und was werdet ihr mit uns tun?«
»Wenn ihr unsere Befehle befolgt, dann habt ihr die
gleichen Chancen wie wir. Ich zähle auf Sie und Ihre
Männer, damit Sie uns während unseres Marsches
beschützen. Wenn wir unser Ziel erreicht haben,
könnt ihr gehen, wohin ihr wollt.«
»Wohin soll unser Marsch gehen?«
»Zur Erd-Enklave.«
Morwatz legte die Stirn in Falten. »Ich kenne die-
sen Ort nicht. Wieviele Ligen ist das von hier ent-
fernt?«
»Vierzigtausend Meilen. Dreizehntausend Ligen.«
Morwatz' Schritt kam ins Stocken. »Sie sind ver-
rückt!«
Glystra lachte. »Wir alle haben unseren Ärger dem
gleichen Mann zu verdanken.« Er wies mit dem
Daumen nach hinten. »Abbigens.«
Morwatz fiel es schwer, seine Gedanken zu ordnen.
»Zuerst kommt das Nomadenland und die Zigeuner.
Wenn sie uns gefangennehmen, dann werden sie uns
wie Zipangoten vor ihre Wagen spannen.« Er machte
eine Kopfbewegung in Richtung auf die Packtiere.
»Es sind Menschen einer anderen Rasse, und sie ver-
achten alles, was aus Beaujolais kommt.«
»Sie werden fünfzig Männer vielleicht nicht so
leicht angreifen, wie es bei nur acht Männern der Fall
wäre.«
Morwatz schüttelte heftig verneinend den Kopf.
»Beim letzten Sechs-Mond ist Atman der Gnadenlose
tief nach Beaujolais eingefallen, und er hat sich seinen
Weg mit Schrecken und Pein geebnet.«
Glystra spähte durch die Baumstämme hindurch,
die jetzt schon weniger dicht beisammenstanden, auf

den offenen, vor ihnen flach auslaufenden Hang.
»Vor uns also liegt das Land der Nomaden. Was
kommt danach?«
»Nach dem Land der Nomaden?« Morwatz legte
die Stirn in Falten. »Zunächst der Fluß Oust. Dann
die Sümpfe, und die Seilmacher der Sumpfinsel. Und
nach den Sümpfen ...«
»Ja?«
»Was direkt östlich liegt, weiß ich nicht. Wilde
Menschen, wilde Tiere. Südlich liegt ein Land, das
Felissima genannt wird, und Kirstendale, und die
Monobahn zum Brunnen am Myrtensee und dem
Orakel. Nach dem Myrtensee kommt das Land der
Steine, aber davon habe ich keine nähere Kenntnis
mehr, weil es zu weit östlich liegt.«
»Wieviele Ligen?«
»Ein paar hundert. Aber es ist schwierig, das genau
zu bestimmen. Von hier bis zum Fluß – sagen wir
fünf Tage. Um ihn zu überqueren, müßt ihr die
Edelweiß-Hochbahn zur Sumpfinsel benutzen, oder
ihr müßt dem Fluß Oust in südwestlicher Richtung
zurück nach Beaujolais folgen.«
»Warum können wir den Fluß nicht in Booten
überqueren?«
»Die Griamobots«, verriet Morwatz mit wissender
Miene.
»Und was ist das?«
»Wilde Flußungeheuer. Schrecklich.«
»Hm. Und nach dem Fluß? Was dann? Wie kom-
men wir durch die Sümpfe?«
Morwatz rechnete. »Wenn ihr eure Reise östlich
fortsetzt, braucht ihr vier Tage – vorausgesetzt, ihr
findet einen guten Sumpfwagen. Wenn ihr euch in

Richtung Süden halten wollt, dann könnt ihr die Mo-
nobahn nehmen, die am Marschland vorbeiführt –
dem Hibernianischen Marschland – bis nach Kirsten-
dale. Das wäre in sechs Tagen oder einer Woche zu
schaffen. Wenn es euch gelingen sollte, Kirstendale
wieder zu verlassen –«
»Warum sollten wir das nicht?«
»Einigen gelingt es«, sagte Morwatz und blinzelte
wiederholt mit den Augen. »Einigen nicht ... Von Kir-
stendale aus führt die Monobahn weiter westlich
nach Grosgarth, südlich durch die Handelsdörfer von
Felissima, östlich zum Myrtenseebrunnen.«
»Wie weit ist es von Kirstendale zum Myrtensee?«
Morwatz machte eine ausladende Geste. »Vielleicht
zwei oder drei Tage mit der Monobahn. Ansonsten
eine sehr gefährliche Reise, wegen der Stämme, die
von Eyrie herabkommen.«
»Und jenseits des Myrtensees?«
»Wüste.«
»Und jenseits der Wüste?«
Morwatz zuckte die Schultern. »Das wäre eine Fra-
ge für den Zauberbrunnen. Wenn Sie wohlhabend
sind und genug Metall zahlen, dann wird er Ihnen
alles sagen, was Sie wissen wollen.« Es war offen-
sichtlich, daß Morwatz mit voller Überzeugung
sprach.
Das Blätterwerk über ihnen verdünnte sich, und
die Marschreihe trat in das grelle Tageslicht des Gro-
ßen Planeten hinaus. Der Hang vor ihnen rollte all-
mählich aus. Es war keine menschliche Behausung,
nicht einmal eine Ruine in Sicht, aber in Richtung
Norden konnten sie eine dichte Rauchsäule ausma-
chen, die vom Wind ostwärts gedreht wurde.

Glystra hielt die Reihe an und gruppierte die Sol-
daten zu einer rechteckigen Formation um die Ge-
päcktiere herum – Zipangoten, wie Morwatz sie
nannte. Das Tier, das die Pfeile trug, wurde von Elton
bewacht, der auf einer Tragbahre direkt dahinter saß.
Er hatte ein Katapult und Pfeile bei der Hand, wäh-
rend sich das Hitzegewehr – vor überraschendem
Zugriff sicher – in seiner Jacke befand. Abbigens ging
am äußersten Ende rechts vorne, Morwatz links hin-
ten. Pianza und Fayne flankierten links und rechts als
Aufpasser mit Ionenstrahlern; dahinter kamen Bishop
und Ketch.
Zwei Stunden vor Mittag befanden sie sich inmit-
ten des Ödlands, und während sie dahinmarschier-
ten, verlor die gewaltige Erhebung hinter ihnen zuse-
hends von ihrer eindrucksvollen Größe. Die höheren
Bereiche verschwanden im Dunst, und der Wald
wurde zu einem dunklen Streifen. Der Hang wirkte
aus dieser Entfernung weniger steil.
Von den Soldaten her drang gedämpftes Murmeln
an sein Ohr. Sie stockten im Schritt, und das Weiße in
ihren Augen leuchtete hervor.
Claude Glystra folgte ihrer Blickrichtung und sah
entlang des Horizonts ein Dutzend großer Zipango-
ten, die etwas auf dem Rücken trugen und sich ohne
besondere Eile zu nähern schienen.
»Was ist das? Zigeuner?«
Morwatz blickte mit angespannter Miene zu der
Reihe hinüber. »Es sind Zigeuner, aber keine. Kosa-
ken. Sie gehören einer höheren Kriegerkaste an, viel-
leicht sind es sogar Politboros. Nur die Politboros
reiten Zipangoten. Kosaken sind leicht abzuwehren –
sie haben wenig Kampfgeist, keine Disziplin, keine

Strategie, kein Hirn. Sobald sie ein paar Gefangene
haben, die sie verkaufen oder vor ihre Wagen span-
nen können, sind sie zufrieden. Aber die Politboros
...« Seine Stimme erstarb, und er schüttelte den Kopf.
»Was ist mit den Politboros?« drängte Glystra.
»Sie sind die großen Krieger, die Anführer. Die Ko-
saken allein sind bloße Räuber. Wenn ein Politboro
sie anführt – werden sie zu Dämonen!«
Glystra sah zu Bishop hinüber. »Was wissen wir
über diese Zigeuner, Steve?«
»Es gibt da ein kurzes Kapitel in Vendomes Buch
vom Großen Planeten, das von den Zigeunern handelt,
aber das Schwergewicht liegt mehr auf ihrem rassi-
schen Hintergrund denn auf ihrer Kultur. Sie sollen
von einem kirgistischen Hirtenvolk von der Erde ab-
stammen. Kurdestan, glaube ich. Als die Wetterkon-
trolle die Regenfälle jenseits des Kaukasus verstärkte,
wanderten sie zum Großen Planeten aus, wo die
Steppen voraussichtlich Steppen bleiben würden. Sie
schifften sich in der dritten Klasse aus, und im glei-
chen Schiff befand sich ein Stamm traditionsbewußter
Zigeuner und eine Bruderschaft von Polynesiern.
Während der Reise brachte der Chef der Zigeuner,
der Panvilsap genannt wurde, den kirgisischen
Hauptmann um und heiratete die polynesische Mat-
riarchin. Als sie auf dem Großen Planeten ankamen,
hatte er die ganze Gruppe unter Kontrolle. Die sich
daraus ergebende Kultur war ein Gemisch aus Kirgi-
sisch, Polynesisch und Romanisch, und wurde domi-
niert von der Persönlichkeit Panvilsaps.«
Die heranreitende Reihe war jetzt bereits weniger
als eine Meile entfernt, näherte sich ohne besondere
Eile.

»Wieso beschäftigen Sie sich mit den Besonderhei-
ten ihrer Kultur?« fragte Morwatz erregt. »Noch
heute abend werden wir gleich Zipangoten ihre Wa-
gen ziehen.«

7
Die Sonne stand im Zenit, und die angesengte grau-
grüne Vegetation der Steppe verbreitete ein rauchiges
Aroma. Während sich die berittenen Zipangoten nä-
herten, wurden dahinter allmählich Gruppen von
Kosaken sichtbar, die sich hinter den langsam dahin-
stapfenden Tieren hielten.
»Ist das ihre übliche Angriffsmethode?« wollte
Glystra von Morwatz wissen.
»Sie halten sich nicht an bestimmte Methoden.«
»Befehlen Sie Ihren Leuten, jeweils fünf Pfeile an
sich zu nehmen und sich bereitzuhalten.«
Morwatz straffte sich, schien von einem Augen-
blick zum andern an Statur zu gewinnen. Er ging vor
den Soldaten hin und her, bellte Befehle. Sie nahmen
Haltung an, bildeten dichtere Reihen. In Fünfergrup-
pen schritten sie zu dem Packtier, das die Pfeile trug,
und traten dann wieder in ihre Reihen zurück.
»Fürchtest du nicht –« setzte Bishop skeptisch an.
»Wir müssen uns davor hüten, so zu wirken, als
fürchteten wir etwas«, sagte Glystra. »Dann wären sie
nämlich weg in Richtung Wald wie wilde Kaninchen.
Es ist eine Frage der Moral. Wir müssen uns so ver-
halten, als wären diese Zigeuner Staub unter unseren
Füßen.«
»Ich glaube, du hast recht – theoretisch.«
Die berittene Reihe kam etwa dreißig bis vierzig
Meter vor ihnen zum Halten, gerade noch außerhalb
der Reichweite ihrer Katapulte. Die Tiere waren
schwerer als die in ihrem Gepäckzug. Sie wurden von
abgewetzten Lederzügeln gehalten, die mit kruden

Symbolen verziert waren, und ein jedes trug ein rhi-
nozerosähnliches Horn, das an seiner Schnauze befe-
stigt war.
Ein großer, stämmiger Mann saß auf dem ersten
der Zipangoten. Er trug blaue Seidenhosen, einen
kurzen schwarzen Umhang, eine schirmmützenähnli-
che Kopfbedeckung aus Leder. An seinen Ohren hin-
gen Messingringe von fast zehn Zentimetern Durch-
messer, und auf beiden Brustseiten glänzte eine Me-
daille. Er hatte ein rundliches, muskulöses Gesicht,
aus dem dichte Augenbrauen hervorstachen.
Glystra vernahm, wie Morwatz entgeistert mur-
melte: »Atman der Gnadenlose!«
Claude Glystra betrachtete den Mann erneut und
konnte an ihm nicht das geringste Anzeichen einer
Anspannung ausmachen. Es war ein gleichgültiges
Selbstvertrauen, das alarmierender wirkte als jede
Form von Arroganz. Hinter ihm ritt ein Dutzend
Männer, die eine ähnliche Kluft trugen wie er. Da-
hinter lauerten etwa hundert Männer und Frauen in
weiten Hosen, geschmückt mit Bändern und Quasten,
schweren Barchentjacken und Ledermützen.
Glystra wandte sich ab, um die Formation der ei-
genen Soldaten zu überprüfen – in diesem Augen-
blick fegte etwas dicht an seiner Kehle vorbei, bösar-
tig summend wie eine Hornisse. Er wich zurück,
duckte sich und sah voll in das flache Gesicht von
Abbigens, der sein Katapult mit einem seltsam leeren
Ausdruck senkte.
»Morwatz«, sagte Glystra, »lassen Sie Abbigens das
Katapult abnehmen und an Händen und Füßen fes-
seln.«
Morwatz zögerte kaum merklich, gab dann die

Anweisung an zwei Soldaten weiter.
Das Schlurfen von Füßen war zu vernehmen, was
Glystra jedoch zunächst ignorierte – denn Atman und
seine Politboros waren abgestiegen und näherten sich
ihnen.
Atman hielt ein paar Schritte vor ihnen an und lä-
chelte dünn. »Was denkt ihr euch, da ihr in das Land
der Zigeuner eindringt?« Er sprach weich und flie-
ßend.
»Wir sind nach Kirstendale unterwegs, am
Marschland vorbei«, sagte Glystra. »Der Weg führt
durch das Nomadenland.«
Atman zog seine Lippen zurück und ließ seine
Zähne sichtbar werden, in die auf kunstvolle Weise
kleinste Stückchen farbigen Gesteins eingelassen wa-
ren. »Ihr gebt eure Freiheit auf, indem ihr dieses Land
betretet.«
»Das Risiko liegt bei denen, die uns versklaven
wollen.«
»Sollen diese Soldaten vielleicht ein Hindernis für
uns bedeuten?« Atman machte eine verächtliche Ge-
ste.
Glystra vernahm ein Wimmern, einen Schrei.
»Claude – Claude –«
Ein heißer Blutschwall drang in sein Gehirn. Er
stand leicht schwankend da, wurde sich dann dessen
bewußt, daß Atman ihn amüsiert beobachtete. »Wer
ruft meinen Namen?«
Atman sah nachlässig über seine Schulter zurück.
»Eine Frau, die wir heute morgen nahe dem Wald ge-
funden haben. Sie wird uns einen guten Preis brin-
gen.«
»Laß sie vorbringen«, sagte Glystra. »Ich werde sie

euch abkaufen.«
»Ihr seid also reich?« bemerkte Atman. »Fürwahr,
dies ist ein glücklicher Tag für die Zigeuner.«
Glystra versuchte, seine Stimme ruhig zu halten.
»Bringt diese Frau her, oder ich werde einen Mann
schicken, der sie holt.«
»Einen Mann? Einen Mann?« Atmans Augen ver-
engten sich. »Was für einer Rasse von Menschen ge-
hört ihr an? Ihr seid nicht aus Beaujolais wie die an-
deren, aber ihr seid dunkler als die Maquir ...«
Glystra zog wie beiläufig seinen Ionenstrahler her-
vor. »Ich bin Elektriker.« Er grinste über seinen eige-
nen Witz.
Atman rieb sich sein schweres Kinn. »Elektriker ...
in welchen Gebieten leben sie?«
»Es ist keine Rasse; es ist ein Beruf.«
»Aha! Wir haben keine solchen unter uns; wir ge-
hen unseren eigenen Tätigkeiten nach. Wir sind Krie-
ger und Sklavenjäger.«
Glystra hatte eine ernste Entscheidung getroffen. Er
wandte den Kopf. »Bringt Abbigens vor.« Und zu
Atman gewandt: »Elektriker tragen den Tod in jeder
ihrer Bewegungen.«
Abbigens wurde nach vorn gestoßen. Glystra er-
klärte ihm: »Wenn es keinen praktischen Zweck er-
füllen würde, dich zu töten, dann würde ich dich
vermutlich zur Buße noch bis zur Erdenklave laufen
lassen.« Er hob den Ionenstrahler. Abbigens' Gesicht
war wie aufgegangener Teig; er begann wie wahn-
sinnig zu lachen. »Was für ein Witz! Was für ein Witz
auf deine Kosten, Glystra!« Der violette Strahl kam
auf, Energie zuckte durch den konduktiven Bereich.
Abbigens war tot.

Atman machte einen etwas gelangweilten Ein-
druck.
»Gib mir die Frau«, sagte Glystra, »oder ich werde
diesen gleichen Tod über euch alle bringen.« Er hatte
diesen herrischen Ton angeschlagen, der keinen Wi-
derspruch duldete. »Schnell!«
Atman sah leicht überrascht hoch, zögerte, machte
dann eine Bewegung zu seinen Männern hin. »Laßt
sie ihn haben.«
Nancy kam humpelnd vorwärts, fiel zitternd und
aufschluchzend vor Glystras Füße. Er ignorierte sie;
statt dessen sagte er zu Atman: »Geht ihr euren Weg,
und wir werden den unseren gehen.«
Atman hatte seine Fassung wiedergewonnen, wenn
er überhaupt etwas davon verloren hatte. »Ich habe
diese elektrischen Keulen bereits gesehen. Aber sie
töten auch nicht sicherer als unsere Lanzen. Insbe-
sondere im Dunkeln, wenn Lanzen aus vielen Rich-
tungen kommen und die Keule nur in eine Richtung
weist.«
Glystra wandte sich an Morwatz. »Wir marschieren
los.«
Morwatz riß seinen Arm hoch und nieder und
bellte: »Vorwärts!«
Atman nickte mit einem zweideutigen Lächeln.
»Vielleicht werden wir uns wieder begegnen.«
Der große Hügel war nur noch ein Schatten hinter
den Dunstwolken im Westen; die Steppe dehnte sich
gleich einem Ozean. Und hinter ihnen waren die Zi-
geuner, wobei sich die Kosaken um die Politboros
drängten, die, auf ihren Zipangoten reitend, deutlich
herausragten.
Am späten Nachmittag erschien ein dunkler

Schatten in der Ferne. »Sieht nach Bäumen aus«, sagte
Fayne, »vermutlich eine Wasserstelle.«
Claude Glystra suchte den Horizont in allen Rich-
tungen ab. »Es scheint die einzige Zuflucht zu sein,
die wir von hier erreichen können. Das wird also un-
ser Nachtlager werden.« Er sah sich nach den schwa-
chen Umrissen in der Ferne hinter ihnen um. »Ich
fürchte, uns steht noch weit mehr Ärger bevor.«
Die Schatten gewannen an Dichte, wurden zu einer
Ansammlung von etwa einem Dutzend Bäumen. Um
sie herum lagen Teppiche blau-weißen Mooses und
üppigen Grases.
Inmitten dieser blühenden Vegetation befand sich
ein kleiner Teich, umstanden von rostfarbenem
Schilfrohr. Glystra betrachtete das Wasser mißtrau-
isch. Es wirkte brackig, aber die Leute aus Beaujolais
tranken es mit Begeisterung. Neben dem Teich stand
ein mittelgroßer Schuppen, gefüllt mit Zweigen, an
denen Früchte ähnlich irdischen Eicheln hingen; ne-
ben dem Schuppen standen Fässer mit überreifem
Bier sowie eine primitive Destillieranlage.
Die Soldaten näherten sich neugierig der Destillier-
apparatur. Morwatz lief ihnen schreiend hinterher,
um sie aufzuhalten; zögernd zogen sie sich wieder
zurück.
Glystra nahm einen kleinen Becher aus einem der
Gepäckstücke und reichte ihn Morwatz. »Jeder eurer
Männer soll eine etwas gleiche Menge davon erhal-
ten.«
Lautstarke Zustimmung wurde ihm zuteil, und
Glystra sagte zu Pianza: »Wenn wir ihnen jeden
Abend Grog verabreichen könnten, dann brauchten
wir überhaupt nicht mehr auf sie aufzupassen.«

Pianza schüttelte den Kopf. »Sie sind wie Kinder.
Sehr wenig emotionale Kontrolle. Ich hoffe nur, daß
sie uns nicht auch noch eine Menge Ärger machen.«
»Alkohol oder nicht, wir können uns nicht ent-
spannen. Du und Fayne, ihr nehmt die ersten vier
Stunden, Bishop, Ketch und ich werden die nächsten
vier nehmen. Paßt gut auf das Tier mit den Pfeilen
auf.« Er ging, um den Verband um Eltons Nacken zu
wechseln, aber Nancy war ihm dabei schon zuvorge-
kommen.
Die Soldaten hatten zu singen begonnen und er-
richteten ein Feuer, auf das sie eine ziemliche Menge
von Zweigen aus dem Schuppen schichteten, um de-
ren aromatischen Rauch einzuatmen. Pianza wandte
sich besorgt an Glystra: »Sie sind sturzbetrunken. Ich
hoffe, sie werden nicht noch schlimmer.«
Glystra sah mit wachsendem Verständnis zu. Die
Soldaten versuchten, schreiend und stoßend näher an
das Feuer zu kommen, kämpften sich in die dichte-
sten Rauchwolken vor, blieben darin stehen mit när-
risch verzogenen Gesichtern. Wurden sie zur Seite
gedrängt, so kämpften sie sich schreiend sogleich
wieder nach vorn, in den dichten Rauch hinein.
»Muß wohl ein Narkotikum sein«, stellte Glystra
fest. »Das Marihuana des Großen Planeten.« Er trat
vor. »Morwatz!«
Morwatz hatte entzündete Augen und ein stark er-
rötetes Gesicht, da er sich selbst im dichten Rauch
aufgehalten hatte. Er wandte sich zögernd Glystra zu.
»Ihre Männer sollen essen und sich niederlegen, aber
nicht mehr von diesem Rauch einatmen.«
Morwatz gab gedehnt seine Zustimmung kund. Er
wandte sich seinen Männern zu, und nach längerem

und lautstarkem Fluchen gelang es ihm, wieder so
etwas wie Ordnung in das Lager zu bringen. In einer
Terrine wurde eine breiartige Mahlzeit zubereitet –
zerkleinertes Getreide, abgeschmeckt mit einigen
Handvoll trockener Fleischstücke und Pilze.
Glystra ließ sich neben Morwatz nieder, der sich
unweit seiner Leute zum Essen niedergesetzt hatte.
»Was ist das für ein Zeug?« Er deutete auf den
Schuppen.
»Es wird Zygage genannt – eine sehr starke Droge,
sehr nützlich.« Er richtete sich auf. »Im allgemeinen
inhalieren nur die niedrigsten Kasten diesen Rauch –
es ist vulgär, verursacht die krudesten Empfindungen
–«
»In welcher Form nehmen Sie es dann gewöhnlich
ein?«
Morwatz atmete schwer. »Ich pflege so etwas ei-
gentlich überhaupt nicht zu nehmen. Zygage nimmt
zuviel Vitalität; ob Rauch, Tinktur oder Nasensalbe,
der Benutzer zahlt teuer für sein Vergnügen ... Aber
sehen Sie dort, was für eine Art von Droge nimmt Ihr
Mann denn?«
Steve Bishop schluckte soeben seine unerläßlichen
Vitaminpillen.
Claude Glystra grinste. »Das ist eine ganz andere
Art von Droge. Es läßt Bishop glauben, daß er gesund
ist. Er würde niemals den Unterschied merken, wenn
ihm jemand Kreidekügelchen unterschöbe.«
Morwatz war sichtlich überrascht. »Wieder einer
dieser seltsamen und sinnlosen irdischen Gebräu-
che.«
Glystra kehrte zu seinen Begleitern zurück. Nancy
kümmerte sich um Elton, setzte sich dann so unauf-

fällig wie möglich irgendwo zwischen die Zipango-
ten.
Vom Feuer her kam ein plötzlicher Tumult. Ein
Soldat hatte unbemerkt eine erneute Ladung von Zy-
gagenzweigen in die Flammen geworfen, und Mor-
watz ging wütend auf ihn los. Der Soldat, taumelnd
und mit rotunterlaufenen Augen, schrie ihn heiser an.
Glystra seufzte. »Das nenne ich Disziplin. Nun, ich
glaube, wir müssen ein Exempel statuieren.« Damit
erhob er sich.
Morwatz zog soeben die rauchenden Zweige aus
dem lodernden Feuer; der Soldat schlich heran und
trat ihn von hinten. Morwatz fiel mit dem Gesicht
nach unten auf die Kohlen.
Roger Fayne lief los, um den schreienden Morwatz
herauszuziehen; drei Soldaten sprangen ihn von hin-
ten an und drückten ihn nieder. Pianza zielte mit dem
Ionenstrahler, feuerte aber nicht, da er fürchtete, Fay-
ne treffen zu können. Soldaten kamen aus allen
Richtungen auf ihn zu. Er zielte, feuerte: Klick – klick –
klick. Drei Soldaten fielen flach hin, eingeschrumpftes
Fleisch. Die anderen fielen über ihn her.
Die Lichtung war plötzlich von schreienden, wild-
gewordenen Männern bevölkert. Einer sprang Ketch
an, warf ihn um. Glystra tötete ihn mit seinem Ionen-
strahler, spürte dann plötzlich, wie kräftige Arme von
hinten an ihm rissen, ihn zu Boden zogen.
Die Erdenmänner lagen wehrlos da, die Arme hin-
ter ihrem Rücken zusammengebunden.
Unweit von ihnen lag Morwatz, entrang seiner
Brust ein tiefes, gequältes Seufzen. Der Mann, der ihn
zuerst getreten hatte, zog sein Schwert und durch-
bohrte ihn. Er wandte sich um und sah seine Gefan-

genen an, tippte mit seinem Schwert an Glystras
Kinn. »Du wirst deinen Tod nicht von meiner Hand
finden. Ihr kommt mit zurück nach Grosgarth, und
der Bajarnum wird uns belohnen, indem er uns zu
Edelleuten macht ... Soll Charley Lysidder seinen
Willen mit euch haben ...«
»Die Zigeuner!« sagte Glystra mit rauchiger Stim-
me. »Sie werden uns alle bekommen!«
»Pah. Sie sind nur schmutzige Tiere!« Er schwang
sein Schwert in einem wilden Bogen um sich herum.
»Wir werden sie umbringen, wie sie kommen!« Er
stieß einen wilden Schrei aus, der verriet, wie wenig
die Drogen von seiner Selbstbeherrschung übrigge-
lassen hatten. Er lief zu dem Schuppen und warf ei-
nen Arm voll Zweige nach dem anderen in die
Flammen. Dichter Rauch bildete sich, und die Solda-
ten inhalierten ihn begierig.
Glystra zog an seinen Fesseln, aber sie waren gut
gebunden und so fest verknotet, daß ihm die Hände
abzusterben drohten. Er wandte mühsam den Kopf.
Wo war Nancy?
Da war ein entferntes Geräusch, das er auf einmal
vernahm, ein entferntes Singen von der Steppe her,
das manchmal unterbrochen schien durch den Klang
eines tiefen Horns.
Die Windrichtung verlagerte sich. Rauch von den
glimmenden Zygagenzweigen wehte über die gefes-
selten Erdenmänner hinweg. So sehr sie sich auch
drehen und wenden mochten, sie konnten den Rauch
nicht vermeiden. Stehend und süß stieg er in ihre Na-
sen.
Die erste Empfindung war die einer vielfachen
Stärke, einer vertausendfachten Wahrnehmungsfä-

higkeit, ein Sehen, Hören, Fühlen und Riechen, das
bis in die kleinsten Einzelheiten ging und zugleich
umfassend war. Jedes Blatt am Baum wurde zu einer
eigenen Wesenheit, jeder Pulsschlag zu einer einma-
ligen und einzigartigen Erfahrung. Schwärme von
angenehmen Erfahrungen füllten das Bewußtsein
aus. Zugleich war ein anderer Teil des Bewußtseins
außergewöhnlich aktiv; Probleme wurden zu Baga-
tellen; Beschwernisse – wie etwa die Fesseln und die
Aussicht, durch Charley Lysidders Hände zu sterben
– waren nur Details am Rande, kaum der Beachtung
wert. Und währenddessen wurde das Singen in der
Ferne lauter. Glystra hörte es; gewiß mußten es die
Soldaten ebenso hören ...
Das Singen war laut, kam aus nächster Nähe. End-
lich reagierten die Männer aus Beaujolais. Sie tau-
melten vom Feuer weg, die schwarzen Hüte saßen
fast durchweg schräg auf ihren Köpfen, ihre Augen
traten hervor, waren blutunterlaufen, die Gesichter
waren verzerrt, die Münder standen offen und
schnappten nach Luft.
Der Anführer hob seinen Kopf wie ein Wolf und
stieß einen Schrei aus.
Dieser Schrei gefiel den Männern aus Beaujolais.
Sie alle warfen die Köpfe zurück und stimmten in ihn
ein. Lachend und schreiend beluden sie sich jetzt mit
Pfeilen und liefen aus der Oase hinaus, der Zigeuner-
horde entgegen.
Der Anführer bellte etwas; die Soldaten ordneten
sich zu einer lockeren Formation, ohne innezuhalten,
und verloren sich im entfernten Widerschein des
Feuers.
Die Oase war jetzt ruhig. Glystra rollte sich auf sei-

ne Knie, kämpfte sich hoch, suchte nach irgend etwas,
um seine Fesseln zu lösen. »Bleib so!« rief Pianza mit
unterdrückter Stimme. »Ich werde sehen, ob ich die
Lederriemen lösen kann.« Er erhob sich ebenfalls auf
seine Knie und kämpfte sich auf die Füße hoch. Mit
dem Rücken zu Glystra, versuchte er an dessen Fes-
seln zu hantieren.
Er keuchte verzweifelt. »Meine Finger sind ganz
lahm ... ich kann meine Hände nicht bewegen ...«
Die Soldaten von Beaujolais befanden sich jetzt in-
mitten der zwielichtigen Steppe; die Zigeuner hatten
zu singen aufgehört, und nur der tiefe Klang des
Horns war noch zu vernehmen. Die Einzelheiten
verloren sich in der abendlichen Dämmerung; Glystra
konnte sehen, wie Männer fielen; es folgte ein wilder
Gegenangriff von Seiten der Soldaten aus Beaujolais.
Die Schlacht verlor sich in der Dämmerung.

8
Glystra versuchte die Knoten an Pianzas Handgelen-
ken zu lösen, doch ohne Erfolg. Seine Finger fühlten
sich wie Würste an, ohne jede Empfindung. Er spürte
plötzlich seine Schwäche; sein Denken war träge. Die
Nachwirkungen der Droge.
Das eine Augenlid zuckte immer noch auf und zu.
Nancy tauchte unerwartet darin auf – bleichgesichtig
und mit weit aufgerissenen Augen.
»Nancy! Komm her, schnell!«
Sie sah Glystra wie benommen an, bewegte sich
unsicher vorwärts, hielt inne, sah zurück in Richtung
auf das Durcheinander in der Steppe.
Die Ausrufe der Soldaten aus Beaujolais wurden
immer schriller, wilder, triumphierender.
»Nancy!« rief Glystra. »Schneide uns los – bevor sie
zurückkommen und uns umbringen!«
Nancy sah ihn mit einem seltsam nachdenklichen
Ausdruck an.
Hornstöße klangen gleich Glocken durch die Luft.
Das Schreien der Leute aus Beaujolais ließ nach. Eine
Stimme erhob sich über all die anderen: Atman der
Gnadenlose.
»Nancy!« schrie Glystra. »Komm her! Binde uns
los! Sie können jede Minute hier sein.«
Sie sprang vorwärts, riß ein Messer heraus. Ein
paar gezielte Schnitte. Die Erdenmänner standen da,
rieben sich ihre Handgelenke, zogen Grimassen ob
der Schmerzen, die ihnen die wiederhergestellte Blut-
zirkulation verursachte, apathisch durch die nachlas-
sende Wirkung des Zygagenrauchs.

»Zumindest sind wir die Sorge los, wie wir die
Soldaten unter Kontrolle behalten«, murmelte
Glystra.
»Die Zigeuner werden heute nacht feiern«, sagte
Bishop. Er wirkte als einziger in der Gruppe voll
wachsam. Tatsächlich war er mehr als wachsam; er
hatte offenbar die geistige Schärfe und die körperli-
che Entspanntheit behalten, die die anderen unter
dem Einfluß der Zygage verspürt hatten. Glystra sah
ihm zu, wie er mit kraftvollen Schritten auf und ab
ging. Ihm selbst war zumute, als müsse sein Körper
wie ein nasser Wäschesack nachgeben.
Moss Ketch beugte sich mit der Anstrengung eines
alten Mannes nieder und nahm ein glänzendes Stück
Metall auf. »Ein Ionenstrahler, der einem von uns ab-
handen gekommen ist.«
Glystra suchte die Umgebung ab und fand seine
eigene Waffe dort wieder, wo sie achtlos hingeworfen
worden war. »Hier ist meine ... Sie waren zu aufge-
heizt, um sich noch um irgend etwas zu kümmern.«
Der Wind blies ihm ein wenig Rauch in das Gesicht;
neue Finger des Entzückens schossen in sein Gehirn.
»Verdammt! Dieses Zeug ist stark ...«
Steve Bishop hatte sich ins Gras geworfen und
machte Liegestützen. Da er die Blicke der anderen auf
sich spürte, sprang er wieder auf die Füße. »Ich fühle
mich einfach phantastisch«, sagte er grinsend. »Dieser
Rauch hat mir offenbar gut getan.«
Auf der Steppe draußen war jetzt Stille eingekehrt.
Am Himmel über ihnen blinkten die Sterne.
Der Kriegsgesang der Zigeuner hob erneut an, laut,
diesmal sehr nahe. Etwas zischte von oben heran,
brach durch die Blätter hindurch.
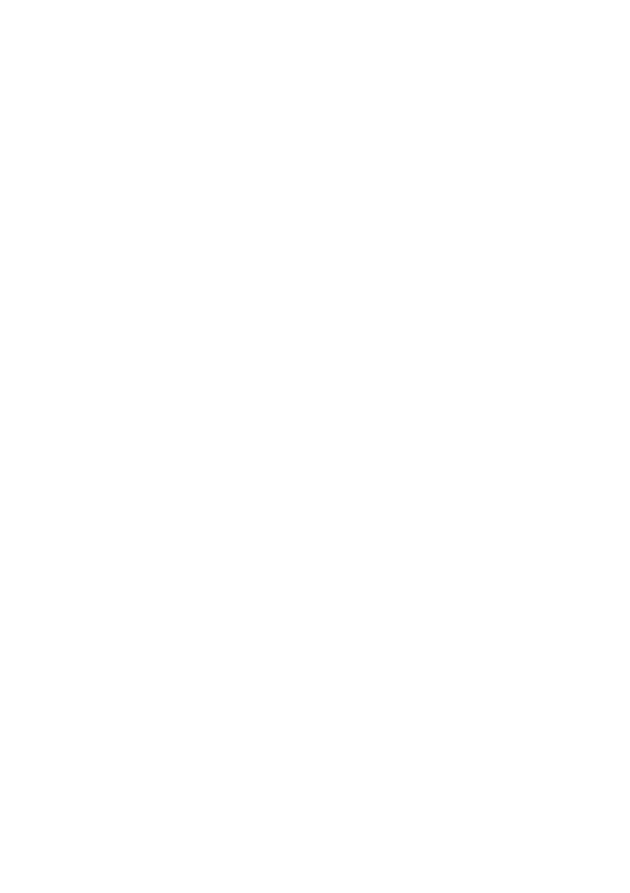
»Nieder!« fauchte Glystra. »Pfeile ... Bewegt euch
vom Feuer weg.«
Der laute Gesang drang bis unter die Haut; er be-
stand aus monotonen Silben, die keinen Sinn ergaben.
Ähnlich laut drang die Stimme Atmans zu ihnen
herüber. »Kommt heraus, ihr seltsamen Geschöpfe,
ihr armseligen Eindringlinge, kommt heraus ... Ich
bin Atman der Gnadenlose, Atman, der Herr der
Sklaven. Euer Leben ist nur eine Bürde für euch, eure
Gedanken sind schwer. Kommt, ich werde euch vor
meine Wagen spannen, und ihr werdet Gras essen,
und da werden keine lästigen Gedanken mehr sein.
Kommt zu Atman ...«
Sie konnten seinen Umriß erkennen, und hinter
ihm einige Zipangoten. Glystra sah über seinen Io-
nenstrahler hinweg, zögerte dann. Es war, als wollte
man einen uralten Baum fällen. »Ihr solltet uns besser
in Ruhe lassen, Atman«, rief er.
Atman stieß einen verachtungsvollen Laut aus. »Ihr
werdet es nicht wagen, mir höher denn auf Knien
entgegenzutreten. Ich werde jetzt kommen, um euch
zu holen; ihr werdet diese elektrischen Spielereien
weglegen und euch vor mir verneigen.«
Glystra setzte benommen dazu an, den Strahler
beiseitezulegen, blinzelte dann, warf den unver-
ständlichen Einfluß Atmans von sich ab. Er drückte
den Anschlag durch. Purpurfarbene Funken spran-
gen zu Atman über und fraßen sich in seine Brust
hinein, wurden darin aufgenommen, absorbiert. Er
leitet zur Erde hin ab! dachte Glystra mit plötzlichem
Entsetzen.
Atman erstrahlte in einer Art von Nachglühen, eine
heldenhafte Gestalt, mehr als lebensgroß ... Bishop

rannte los, erreichte ihn. Atman stieß eine lautstarke
Verwünschung aus. Er beugte sich vor; Bishop drehte
sich, kam von unten wieder hoch. Atman vollführte
eine majestätische Umdrehung, prallte mit einem
hörbaren Aufschlag auf die Erde. Bishop ließ sich wie
beiläufig auf ihm nieder, spielte an seinen Händen
herum, stand wieder auf. Glystra kam heran, noch
immer ganz benommen. »Was hast du nur gemacht?«
»Ein paar Judotricks ausprobiert«, erklärte Bishop
bescheiden. »Ich habe mir gedacht, daß dieser Kerl
seine Schlachten mit seiner Stimme gewinnt, mit
hypnotischer Suggestion. Ich habe ihn totgemacht
wie eine Sardine, mit einem kleinen Schlag auf die
richtige Stelle.«
»Ich habe gar nicht gewußt, daß du ein Judoexperte
bist.«
»Das bin ich nicht ... Ich habe vor ein paar Jahren
ein Buch über dieses Thema gelesen, und es ist plötz-
lich alles über mich gekommen – mein Wort, bei all
diesen Zipangoten!«
»Hm – die müssen den anderen Politboros gehört
haben, die von den Soldaten umgebracht wurden. Die
nehmen wir uns jetzt.«
»Wo sind die anderen Zigeuner?«
Glystra lauschte. Von der Steppe her war kein Laut
mehr zu hören.
»Sie sind weg. Haben sich verdünnisiert.«
Sie führten die Zipangoten mit sich in die Oase zu-
rück. »Wir sollten uns besser auf den Weg machen«,
erklärte Glystra.
Fayne sah ihn an. »Jetzt?«
»Jetzt!« schnappte Glystra. »Mir gefällt das auch
nicht besser als dir, aber wir können jetzt wenigstens

reiten.« Er wies auf die Zipangoten.
Morgen, Mittag, Nachmittag – die Erdenmänner
hingen gekrümmt auf den gewundenen Rücken der
Zipangoten, vor Erschöpfung halb dösend. Die Tiere
gingen ziemlich schwankend, was nicht gerade zum
Einschlafen verführte. Der Abend kam mit einer
langsamen Verdunkelung des Himmels.
Sie erreichten ein Feuer in einer Mulde, kochten ei-
nen Topf voll Getreidebrei und aßen ihn. Sie teilten
Wachen im zweistündlichen Wechsel ein und ließen
sich nieder.
Am nächsten Morgen öffnete Glystra seine Augen
und mußte überrascht mit ansehen, wie Bishop nahe
ihrer Lagerstätte mühelos hin- und hersprintete.
Glystra rieb sich die Augen, gähnte, mühte sich auf
die Füße. Er selbst fühlte sich matt und erschlagen,
und irritiert fragte er Bishop: »Was in aller Welt ist
nur über dich gekommen? Du hast doch noch nie
frühmorgendliche Übungen gemacht!«
Bishops langes Schafgesicht überzog eine leichte
Röte. »Ich verstehe das selbst nicht. Ich fühle mich
einfach so gut. Ich habe mich noch nie in meinem Le-
ben so wohlgefühlt. Vielleicht entfalten meine Vit-
amine jetzt ihre Wirkung.«
»Sie haben nie etwas bewirkt, bevor wir alle mit
dem Rauch dieser Zygagenzweige berauscht wurden.
Dann aber wirkten sie plötzlich wie Wunderpillen,
und du bist losgerast und hast es mit Atman aufge-
nommen.«
»Glaubst du, daß diese Droge eine fortdauernde
Wirkung auf mich hat?«
Glystra rieb sich das Kinn. »Wenn ja, dann wäre

das eine gute Sache – aber warum wirkt es sich bei
uns anderen ganz gegenteilig aus? Wir haben dassel-
be gegessen, dasselbe getrunken ... Außer – ja, außer,
daß du dich mit Vitaminen vollgestopft hast, und
zwar kurz bevor wir mit dem Rauch zu tun beka-
men.«
»Nun ja, das stimmt. Das habe ich getan. Ich frage
mich, ob es da wirklich eine Verbindung geben kann
... ein interessanter Gedanke ...«
»Wenn mir jemals wieder ein Zygagenzweig in die
Hände kommt«, murmelte Glystra, »dann werde ich
es herausfinden.«
Vier Tage lang waren sie von der Dämmerung bis
zum Sonnenuntergang ununterbrochen unterwegs.
Sie bekamen kein menschliches Wesen zu Gesicht, bis
sie am Nachmittag des vierten Tages auf ein paar
junge Zigeunermädchen stießen. Sie waren vielleicht
sechzehn oder siebzehn Jahre alt und führten ein paar
träge Tiere, etwa schafsgroß und mit gelblichem Fell,
mit sich – Pelikanesen. Sie trugen zerknitterte graue
Blusen, und ihre Füße waren mit Riemen umschnürt.
Sie ließen ihre Tiere im Stich und liefen auf sie zu.
»Seid ihr ausländische Sklavenhalter?« fragte die er-
ste glücklich. »Wir wollen Sklaven sein.«
»Tut mir leid«, sagte Glystra trocken. »Wir sind nur
Reisende. Und außerdem sind doch eure eigenen
Leute Sklavenhalter. Warum wollt ihr dann unbe-
dingt zu Ausländern?«
Die Mädchen kicherten und sahen Claude Glystra
dabei an, als ob ihnen seine Frage völlig unverständ-
lich sei. »Sklaven erhalten öfters Mahlzeiten und es-
sen von Tellern. Sklaven können unter ein Dach tre-
ten, wenn der Regen kommt. Zigeuner verkaufen ihre

eigenen Leute nicht, und wir haben es schwerer als
Sklaven.«
Glystra sah sie entschieden an. Wenn er darange-
hen wollte, alles in Ordnung zu bringen, was er in
Unordnung vorfand, dann würden sie niemals die
Erdenklave erreichen. Er sah über seine Schulter zu-
rück.
Elton fing seinen Blick auf. »Ich könnte eine gute
Dienerin gebrauchen«, sagte er leichthin. »Du – wie
ist dein Name?«
»Ich bin Motta. Sie ist Wailie.«
»Noch jemand?« erkundigte sich Glystra schwach.
Pianza schüttelte den Kopf. Roger Fayne schnaubte
und wandte sich ab.
Steve Bishop sammelte Mut und sagte: »Ich nehme
sie.«
Drei weitere Tage ritten sie durch die Steppe, und ein
Tag war wie der andere. Am vierten Tag veränderte
sich das Land. Die Gräser wurden dunkler, und es
wurde schwieriger, was das Reiten anging. Gelegent-
lich tauchten Büsche auf, die bis zu einem Meter
achtzig groß wurden und deren Blätter wie Pfauenfe-
dern aussahen. Vor ihnen erschien ein niedriges
schwarzes Band, das die Zigeunermädchen als das
Ufer des Flusses Oust identifizierten.
Gegen Nachmittag erreichten sie Edelweiß, eine
fortartig befestigte Siedlung, an jeder Ecke von einem
drei Stockwerke hohen Blockhaus begrenzt.
»Manchmal überfallen die Kosaken aus dem Süden
die Magicker«, erklärte Motta. »Es ist ihnen nicht er-
laubt, am hier stattfindenden Ramschmarkt teilzu-
nehmen, da der Anblick bloßer Knie sie wahnsinnig

werden und in mörderischem Amok herumlaufen
läßt. Aber sie begehren das graue Pulversalz, das von
Gammerei den Fluß heraufkommt, und die Magicker
haben davon an Lager, und das ist der Grund, warum
Edelweiß einem befestigten Fort gleichkommt.«
Die Siedlung lag direkt in der Nachmittagssonne,
und aus der Ferne wirkte sie wie eine Ansammlung
von Spielzeughäusern, wie Miniaturen aus dunkel-
braun und hellbraun, mit schwarzen Fenstern, hell-
grünen und schwarzen Dächern. Im Mittelpunkt der
Siedlung erhob sich ein gewaltiger Holzmast, an des-
sen Spitze eine kleine Holzkanzel ähnlich einem
Schiffsausguck befestigt war.
Motta erklärte den Zweck des Mastes. »Das
Tragseil, an dem die Seilbahnkabinen zur Sumpfinsel
hinübergleiten, ist an der Mastenspitze befestigt. Und
außerdem pflegen die Magicker stets in die Ferne zu
sehen; sie erkennen darin, wie die Wolken treiben,
besondere Zeichen, und die Weisen unter ihnen kön-
nen daraus die Zukunft ersehen.«
»Indem sie Wolken beobachten?«
»So habe ich es gehört. Aber wir wissen wenig von
solchen Dingen, da wir Frauen sind.«
Sie setzten ihren Weg zum Fluß dort, und dann sa-
hen sie über den breiten Oust hinweg, die Nachmit-
tagssonne im Rücken. Der Fluß führte vom Norden,
wo er aus dem Dunst der Entfernung hervortrat, her
an ihnen vorbei und verlief weiter in südlicher Rich-
tung, sich dabei ein wenig nach Westen zurückwin-
dend. Das Wasser war sehr unruhig, und manchmal
brachen Fontänen hoch, als zuckte und wütete ein
Ungeheuer unter der Oberfläche des Wassers. Das
gegenüberliegende Ufer, zwei oder drei Meilen ent-

fernt, verlief flach und war mit einem dichten Wald
von Masten bestanden, die gute sechzig Meter hoch
sein mochten. Eine längliche, exotisch bewachsene In-
sel ragte ziemlich genau inmitten des dahinströmen-
den Flusses aus dem Wasser.
»Seht!« rief Fayne mit rauher Stimme – unnötiger-
weise, denn alle Augen waren bereits gleichermaßen
auf das gerichtet, was jetzt in der Flußmitte geschah.
Von der Insel löste sich ein schwarzes Ungeheuer:
Sein Körper war abgerundet und schlank, sein Kopf
froschähnlich und von einem breiten Maul durchzo-
gen. Der Kopf schnellte vorwärts, während sie zusa-
hen, kaute und mampfte auf etwas herum, was sich
im Wasser befand. Schließlich ging es mit dem Kopf
tiefer und ließ sich faul dahintreiben. Das Geschöpf
drehte ab und verschwand wieder hinter der Insel.
Fayne stieß den Atem aus. »Junge! Das ist vielleicht
ein unangenehmer Nachbar!«
Pianza suchte die Wasseroberfläche ab. »Ich frage
mich, ob es überhaupt jemand wagt, über ...«
»Sie werden die Seilbahn benutzen«, erklärte Elton.
Es war ein dünnes weißgraues Seil, das von dem
Masten in der Siedlung zu einem der Pfosten am ge-
genüberliegenden flachen Ufer führte. Der niedrigste
Punkt des hängenden Seils befand sich nur etwas
fünfzehn Meter über der Wasseroberfläche.
Glystra schnaufte verächtlich. »Es gibt offenbar nur
diese eine Art, den Fluß zu überqueren ... ich glaube,
wir müssen uns an der Kasse anstellen ...«
»Auf diese Weise gelangen die Magicker zu ihrem
Reichtum«, sagte Motta.
»Sie werden uns gewiß das letzte Hemd abneh-
men«, murmelte Fayne.
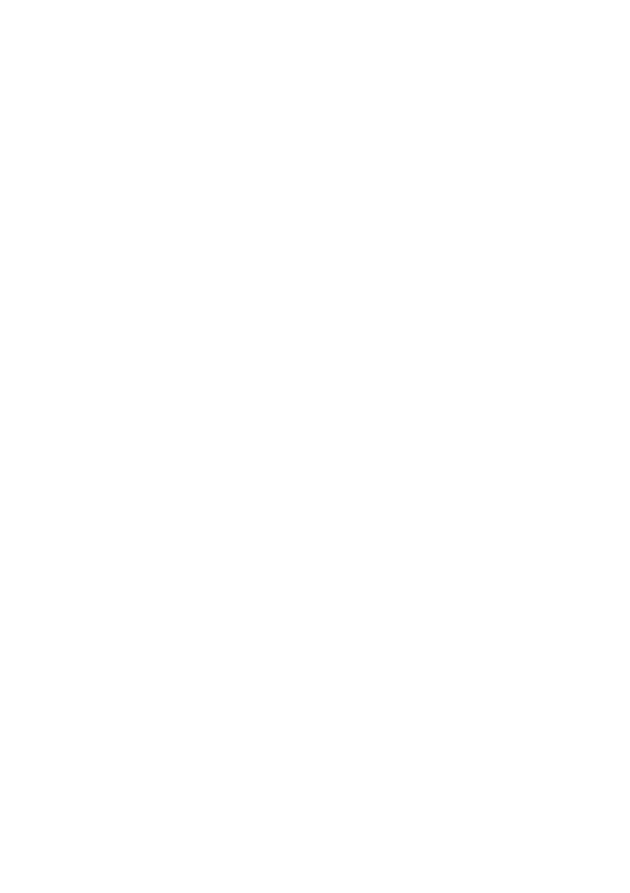
»Uns bleibt nichts anderes übrig«, entschied
Glystra.
Sie gingen am Felsufer entlang auf das Dorf zu.
Über ihnen ragten die Palisaden von Edelweiß em-
por, aus Baumstämmen von einem guten halben Me-
ter Durchmesser zusammengezimmert, die wie Pfei-
ler in den Boden gerammt und gut miteinander ver-
bunden waren. Das Holz wirkte ziemlich nachgiebig.
Glystra überlegte, daß eigentlich jeder, der dazu ent-
schlossen war, sich mit einem Beil seinen Weg ins In-
nere kämpfen konnte.
Sie hielten vor dem Tor an, das noch etwas besser
befestigt war. Es stand offen und ließ einen kurzen
Durchgang frei, der an einer weiteren Palisadenwand
endete.
»Seltsam«, sagte Glystra. »Keine Wachen, kein Tor-
hüter ... überhaupt niemand.«
»Sie haben Angst«, sagte Wailie. Sie hob die Stim-
me. »Magicker! Kommt heraus und führt uns zur
Seilbahn!«
Sie bekam keine direkte Antwort. Nur ein verstoh-
lenes Scharren von jenseits der Holzwand.
»Kommt heraus!« rief Motta. »Oder wir werden
euren Gartenzaun niederbrennen!«
»Guter Gott!« murmelte Pianza. Bishop sah entsetzt
drein.
Wailie suchte ihre Begleiterin noch zu übertreffen.
»Kommt heraus und heißt uns willkommen – oder ihr
alle werdet das Schwert zu spüren bekommen!«
Steve Bishop legte seine Hand über ihren Mund.
»Bist du wahnsinnig?«
»Wir werden die Magicker umbringen«, schrillte

Motta, »und das ganze Dorf in den Fluß werfen!«
Im Durchgang entstand Bewegung. Drei alte Män-
ner,
glatzköpfig
und
schwach,
traten
hervor.
Ihre
blo-
ßen
Füße
waren
knochig
und
von
blauen
Venen
über-
zogen. Sie trugen lediglich zerfetzte Leinenkleider.
»Wer seid ihr?« verlangte der erste zu wissen.
»Geht eures Wegs und stört uns nicht; wir haben
nichts, was von Wert wäre.«
»Wir wollen den Fluß überqueren«, sagte Glystra.
»Helft uns dabei, und wir werden euch nicht länger
belästigen.«
Die alten Männer steckten die Köpfe zusammen
und flüsterten, wobei sie immer wieder mißtrauische
Blicke auf Glystra warfen. Schließlich sagte einer von
ihnen: »Es ist schon spät im Jahr. Ihr müßt warten.«
»Warten?« echote Glystra. »Hier draußen?«
»Wir sind die friedlichen Magicker, unschuldige
Zauberer und Handeltreibende. Ihr seid Männer aus
den Wilden Ländern, und zweifellos wollt ihr uns
unserer Waren berauben.«
»Wir acht? Unsinn. Wir wollen den Fluß überque-
ren.«
»Es ist unmöglich«, sagte der alte Mann mit einem
bebenden Tonfall.
»Warum?«
»Es ist verboten.« Der alte Mann zog sich zurück.
Das Tor fiel zu.
Glystra kaute auf seinen Lippen herum. »Warum
zum Teufel –«
Asa Elton wies zum Turm hoch. »Dort oben ist ein
Heliograph. Er hat Signale in Richtung Westen ge-
sandt. Ich vermute, daß sie Anweisungen aus Beau-
jolais erhalten haben.«

Glystra knurrte unwillig. »In diesem Fall ist es noch
dringender, den Fluß zu überqueren. Hier sind wir in
der Falle.«
Fayne ging in Richtung auf die Uferbank. »Keine
Boote zu sehen.«
»Nicht einmal etwas, woraus sich ein Floß bauen
ließe«, ergänzte Pianza.
»Ein Floß würde uns kaum helfen«, erklärte Fayne.
»Wie sollten wir es bewegen – ohne Segel, ohne Ru-
der?«
Glystra sah die Palisaden von Edelweiß hoch. Elton
grinste. »Denkst du das gleiche, was ich denke?«
»Ich denke an diesen Teil der Palisadenwand – ge-
nau dieses Stück da, das parallel zum Fluß verläuft,
würde ein feines Floß ergeben.«
»Aber wie sollen wir damit den Fluß überqueren?«
verlangte Fayne zu wissen. »Die Strömung ist offen-
bar ziemlich stark; wir würden alle bis zum Golf von
Marwan abgetrieben werden.«
»Es gibt eine Möglichkeit, die auch du kaum über-
sehen kannst.« Glystra formte ein Lasso aus einem
Stück Seil, das zur Gepäckbefestigung gedient hatte.
»Ich werde diese Palisadenwand hinaufklettern;
deckt mich von unten.«
Er warf die Schlinge um einen der breiten Stämme,
zog sich hoch, spähte vorsichtig darüber, kletterte
schließlich ganz darüber hinweg.
Er wandte sich um und sah hinab. »Hier oben ist
niemand. Es ist eine Art von Dach. Einer von euch
soll noch hochkommen – Elton.«
Elton folgte ihm. Vor ihnen waren glatte, noch hö-
her aufragende Wände mit gesicherten Fenstern.
Nichts rührte sich.

9
Ein Geräusch hinter ihnen; Moss Ketch zog sich über
die äußeren Palisaden. »Wollte mal nachsehen, wie es
hier aussieht.« Er sah über die flachen Dächer hin-
weg. »Niedlich hier.«
»Seht euch die Wand an«, sagte Glystra. »Die
Stämme sind oben mit Seilen verbunden und in
mittlerer Höhe mit Holzdübeln gesichert. Wenn wir
das Seil durchtrennen und die Dübel brechen – zum
Beispiel hier, hier und hier – und wenn jeder sich an
einer Seite kräftig dagegenwirft, dann sollte es mög-
lich sein, diesen Teil der Wand regelrecht in den Fluß
zu kippen.«
»Wie steht es mit diesen Seeschlangen – den Gria-
mobots?« fragte Ketch.
»Das ist ein unbekannter Faktor. Wir müssen unser
Glück versuchen.«
»Sie könnten das Floß umwerfen, wenn sie darun-
ter auftauchen.«
Glystra nickte. »Möglich. Willst du lieber hierblei-
ben?«
»Nein.«
Elton streckte seine langen Arme vor sich aus.
»Fangen wir an.«
Glystra sah zum Himmel auf. »Noch eine Stunde
Tageslicht. Bis dahin sollten wir drüben sein, wenn
alles gut geht. Ketch, du gehst wieder hinunter und
führst die ganze Gruppe mit den Zipangoten und al-
lem zum Strand hinab, unterhalb des Felsufers. Ihr
solltet euch möglichst etwas abseits halten, wenn die
Dinge ins Rollen kommen. Wir werden die ganze

Wand hinabwerfen; wenn sie im Fluß landet, dann
befestigt sie irgendwie am Ufer, damit sie nicht ab-
treibt.«
Ketch schwang sich hinab.
Claude Glystra wandte sich wieder der Wand zu.
»Wir müssen es hinter uns bringen, bevor sie merken,
was wir vorhaben.« Er sah seitlich hinab. Etwa sechs
Meter unterhalb war der Rand des Felsufers; dann
waren es noch einmal etwa fünfzehn Meter bis zum
eigentlichen Strand hinab.
Den Strand entlang zogen die Zipangoten mit
Ketch, Pianza, Bishop, Fayne und den drei Mädchen.
Glystra nickte Elton zu, zog sein Messer und
schnitt an den Seilen herum, die die Palisaden oben
zusammenhielten. Plötzlich brach ein wütendes Ge-
heul hinter ihnen los. Vier alte Frauen, zeternd und
gestikulierend, waren offenbar aus dem Nichts er-
schienen. Hinter ihnen traten einige Magicker hervor,
hager, bleich, und um die Schultern herum mit grü-
ner Farbe beschmiert.
Das Seil gab nach. »Jetzt!« sagte Glystra. Er zielte
mit seinem Ionenstrahler und drückte durch. Einmal,
zweimal, dreimal. Sie setzten mit den Schultern an
den Spitzen der Palisaden an und drückten dagegen.
Die Wand gab ein wenig nach, knirschte, bewegte
sich nicht weiter.
»Unten«, keuchte Glystra. »Weiter unten sind noch
weitere Befestigungen.« Er versuchte ins dämmrige
Dunkel unterhalb des Daches zu spähen. »Wir müs-
sen blind schießen ... Brich du die Wand auf deiner
Seite los, ich auf meiner.«
Zwei Kegel purpurfarbenen Lichts gaben zuckende
Energien frei. Eine kleine Feuerzunge leckte an einem

der Stämme, erstarb wieder.
Die Wand gab knirschend nach. »Jetzt – bevor sie
ihre ganze Armee hier heraufrufen können ...«
Die Wand bot ihrem Druck jetzt keinen Widerstand
mehr, sie kippte um und fiel; sie drehte sich im Flug
und landete auf dem Strand, stand eine Sekunde lang
da, fiel endlich klatschend ins Wasser.
Glystra sah noch, wie Ketch mit einem Seil ins
Wasser hechtete, wandte sich dann um und stand ei-
ner ganzen Anzahl von Magickern gegenüber – alle
vom gleichen hageren, finster dreinblickenden Typ.
Sie schimpften lauthals, tänzelten aber wie nervöse
Preiskämpfer zurück, wenn sie ihm ins Auge sahen.
Die Frauen kreischten, zeterten und heulten, aber
die Männer machten nur einige zögernde Schritte
vorwärts. Glystra warf einen Blick zum Fluß hinab.
Die Palisadenwand – jetzt ein Floß – trieb frei dahin,
zerrte an dem Seil, mit dem Ketch es befestigt hatte.
Fayne und Pianza standen am Strand und sahen
hoch. Glystra rief ihnen zu: »Bringt die Tiere auf das
Floß und bindet sie in der Mitte fest!«
Bishop rief etwas, was Glystra nicht verstand; er
wandte sich ab. Die Magicker kamen langsam, aber
doch unaufhaltsam näher. »Geht zurück!« sagte er
tonlos. »Zurück! Oder ich werde euch die Beine unter
dem Leib abtrennen.«
Doch seine Worte taten keine Wirkung. Die Magik-
ker kamen mit verzerrten Gesichtern Schritt um
Schritt näher; ihre angezogenen Lippen ließen ihre
langen Zähne sichtbar werden. Plötzlich schwangen
sie alle über einen Meter lange Stoßpiken mit kleinen
schwarzen Widerhaken.
»Sieht so aus, als ob wir einige von ihnen töten

müßten«, sagte Glystra, »wenn sie es nicht doch noch
mit der Angst bekommen ...« Er zielte mit dem Ionen-
strahler auf das Dach, um dicht vor den Füßen des
nächsten Magickers ein Loch in das Dach zu brennen.
Doch der Magicker sah es nicht einmal; seine Au-
gen waren starr auf einen Punkt gerichtet.
»Sie sind verrückt ... Hysteriker«, murmelte
Glystra. »Arme Teufel, ich mag das nicht ...« Er
drückte durch. Hagere Umrisse verzerrten sich und
gingen zu Boden, andere tanzten zurück über das
Dach zur Treppe hin, unheimliche schwarze Schat-
tenrisse, hinter denen Kleiderfetzen herflogen.
»Haltet ein Seil bereit!« rief Glystra hinab. »Und
bindet es mit dem zusammen, was als nächstes
kommt ...«
Asa Elton sah zu dem Masten hinauf. »Wir sollten
besser das ganze Gestell zum Umstürzen bringen,
den Masten und alles. Andernfalls würde das Seil so
rasch an ihnen vorbeischnellen, daß sie es nicht ein-
mal sehen könnten. Sieh es dir an – drei dieser Halte-
kabel laufen zur Spitze hoch, drei zu einem Punkt in
mittlerer Höhe. Wenn wir die drei an der Spitze ab-
schneiden, dann sollte der Masten leicht und sauber
herunterkommen.«
Glystra untersuchte das Magazin seines Ionen-
strahlers. Er vermochte es in dem nachlassenden Ta-
geslicht nur schwer zu erkennen. »Ich muß jetzt vor-
sichtig mit der Energie umgehen. Habe nicht mehr
viel davon übrig.« Er zielte und drückte den Abzug
durch.
Die drei grauen Halteseile gaben nach, fielen in
schlangengleichen Zuckungen über die Dächer von
Edelweiß. Der Masten gab mit knackenden Geräu-

schen nach, das an eine auseinandergebrochene Ka-
rotte erinnerte, und ging fast vor ihren Füßen nieder.
»Aufgepaßt!« rief Elton nach unten. »Hier kommt
es ...«
Die Spannung des Seils, das zum anderen Ufer
hinüberführte, zog den Masten über das Dach und
schließlich über den Rand des Felsufers.
»Kümmert euch um das Seil«, rief Glystra. »Befe-
stigt das Floß irgendwie daran!« Er begann die Wand
hinunterzuklettern, gefolgt von Elton. Sie liefen am
Rand des Felsufers entlang, bis sie eine Stelle fanden,
von der aus sie zum Strand hinabgelangen konnten.
»Beeilt euch!« rief ihnen Pianza zu. »Unser Strand-
seil hält nicht mehr lange, es kann jede Minute reißen
–«
Glystra und Elton wateten in den Fluß hinaus und
erkletterten das hölzerne Floß. »Los dann!«
Das Floß trieb hinaus. Die Strömung trug es fluß-
abwärts, aber durch das Tragseil der einstigen Seil-
bahn von Edelweiß war es mit dem gegenüberliegen-
den Ufer verbunden.
»Ah«, seufzte Fayne und ließ sich schwer auf die
Stämme fallen, die das Floß ausmachten. »Endlich
Frieden – Ruhe, ist es nicht wundervoll?«
»Warte mit diesen Jubeltönen lieber, bis wir auf der
anderen Seite sind«, sagte Ketch. »Da sind immer
noch die Griambots.«
Fayne machte, daß er wieder auf die Füße kam.
»Die hatte ich glatt vergessen. Mein Gott! Wo sind
sie? Wenn die eine Sache vorbei ist, dann kommt
gleich der nächste Ärger.«
»Seht!« sagte Bishop tonlos. Alle Köpfe wandten
sich gleichzeitig dem Ding zu, das sich langsam über

den Floßrand schob – es war flach, glänzend, fest und
muskulös. Es bebte, zuckte um weitere zwanzig Zen-
timeter auf das Floß hinauf.
Weitere zwanzig Zentimeter ... Eli Pianza lachte.
Bishop ging darauf zu. »Ich dachte, es wäre das Ende
eines Tentakels.«
»Das ist ein größerer Wurm, aber kein Seeunge-
heuer.«
»Ekelhaftes Ding.« Bishop kickte es in den Fluß zu-
rück.
Das Floß ging plötzlich hoch, schwenkte hin und
her. Hohe Wasserfontänen gingen um sie herum
hoch.
»Aber jetzt ist etwas unter uns«, hauchte Glystra.
Motta und Wailie begannen zu schluchzen.
»Ruhig!« schnappte Glystra. Die Bewegungen lie-
ßen wieder nach; das Wasser beruhigte sich.
Steve Bishop berührte Glystra am Arm. »Sieh mal
zum Felsufer hoch – dort, wo sich Edelweiß befin-
det.«
Eine Fackel war entzündet worden. Sie flammte
auf, ging aus, flammte erneut auf, ging aus – wieder
und wieder, in wechselnden Abständen.
»Ein Code. Sie geben eine Botschaft durch. Ver-
mutlich über den Fluß hinweg zur Sumpfinsel. Wir
können nur hoffen, daß niemand das Seil am anderen
Ende abtrennt.«
»Fayne könnte mit einer Botschaft ans Ufer
schwimmen«, schlug Elton vor. Fayne schnaufte ver-
ächtlich, und Elton kicherte.
Von jenseits der Insel näherte sich der Griamobot,
den Kopf suchend erhoben. Die Dunkelheit verhüllte
sein Äußeres; es traten nur die großen Facettenaugen

hervor. Wasser zischte und brodelte an seiner dunk-
len Körpermasse vorbei, aus deren Innerem ein tiefes,
unmenschliches Brüllen hervorkam.
Der Kopf schwenkte hin und her, schnellte plötz-
lich nach vorn.
»Es hat uns gesehen«, murmelte Glystra. Er zog
seinen Ionenstrahler. »Vielleicht kann ich es verletzen
und davonjagen ... Im Magazin ist nicht mehr genug
Energie, um wirklich etwas auszurichten, wenn sich
das Ungeheuer nicht abhalten läßt ...«
»Halte voll auf den Kopf«, sagte Eli Pianza bebend.
»Damit es uns nicht mehr sehen kann.«
Glystra nickte. Der violette Strahl berührte den
Kopf. Er tat seine volle Wirkung, doch der Nacken
schwenkte weiterhin vor und zurück, vor und zurück
– und das Geschöpf verlangsamte weder noch verän-
derte es seine Richtung.
Glystra zielte auf den Körper, feuerte. Ein reißen-
des Geräusch, und in der dunklen Außenhaut er-
schien eine gezackte Öffnung. Weiße Gegenstände
schienen sich dahinter zu bewegen.
Glystra sah es verblüfft und feuerte erneut in die
Höhe der Wasserlinie. Das Ungeheuer schrie auf – in
einem Durcheinander menschlicher Stimmen.
Die Hülle geriet ins Wanken, schien kurz vor dem
Zusammenbruch zu stehen. Weiße Umrisse kletterten
aus der Öffnung heraus.
»Deckung!« rief Glystra. »Sie werfen mit etwas
nach uns!«
Eine Pike schlug in das Holz neben ihm ein. Noch
eine – noch eine – und dann ein Geräusch, das anders
war als zuvor: ein weicher Aufschlag und ein langes,
kehliges Nach-Luft-Schnappen.

Glystra erhob sich. »Ketch!«
Moss Ketch zog schwach an der Pike, die in seiner
Brust steckte, fiel nach vorn auf die Knie, neigte den
Kopf, während er mit beiden Händen den Schaft der
Pike umfaßte; und in dieser Position erstarrte er.
»Sie versuchen uns zu entern!« schrie Fayne.
»Beiseite!« rief Pianza. Fayne bekam seine Ellbogen
zu spüren. Organgefarbenes Feuer trat aus seinem
Hitzegewehr und ergriff die schmalen Umrisse, die
ihre Arme hochwarfen und in den Fluß zurückfielen.
Die Hülle des Griamobots befand sich schon fast
vollständig unter Wasser, trieb flußabwärts am Floß
vorbei und davon.
Claude Glystra legte Ketch vorsichtig auf die Seite.
Seine Hände hatten sich um den Schaft verkrampft.
Glystra stand auf, sah durch die Dämmernis zu
Edelweiß hinüber; einen Augenblick lang stand er so
da, wandte sich dann wieder zu Ketch zurück. »Fay-
ne – hilf mir.«
Er griff nach den Füßen des Toten. Roger Fayne
beugte sich hinab und nahm die Schultern, zögerte.
»Was hast du mit ihm vor?«
»Ihn in den Fluß werfen. Tut mir leid. Wir können
uns keine Gefühle leisten.«
Fayne öffnete den Mund, stammelte etwas. Glystra
wartete.
»Glaubst du nicht«, meinte Fayne schließlich mit
gesenkter Stimme, »daß wir – nun, sind wir ihm nicht
ein ordentliches Begräbnis schuldig?«
»Wo? In den Sümpfen?«
Fayne beugte sich zu dem Körper hinab.
Glystra sah zurück nach Edelweiß. »Der Griamobot
war ein Schwindel. Ein kommerzielles Unternehmen,

um die Leute vom Fluß fernzuhalten und zur Benut-
zung der Edelweiß-Seilbahn zu zwingen.«
Die Nacht lag schwer über dem Großen Planeten,
und auch die Ufer lagen im völligen Dunkel. Auf
dem Floß war völlige Stille eingekehrt. Kleine dunkle
Wellen schlugen gegen die Stämme. Die Strömung
trieb sie flußabwärts; festgehalten durch das am ge-
genüberliegenden Ufer befestigte Seil schob sich das
Floß allmählich in Richtung auf die Sumpfinsel.
Die Masten der Sumpfinsel ragten bereits über ih-
nen hoch. Das Zirpen und Surren von Myriaden win-
ziger Insekten drang an ihre Ohren. Es waren keine
Lichter sichtbar.
Das Floß lief weich auf einem sumpfigen Uferstrei-
fen auf, kam zum Stillstand.
»Wir müssen warten, bis es hell wird«, sagte
Glystra. »Versuchen wir etwas zu schlafen ...«
Aber sie saßen alle da und starrten über die dunk-
len Wasser, spürten den Verlust von Ketch, wie eine
Zunge die Lücke spürt, die ein gezogener Zahn hin-
terlassen hat.
Die Dämmerung kam über das Wasser zu ihnen,
schien aus dem Nirgendwo zu kommen. Im Osten
flammte der Himmel gelb und orange auf, jenseits
der etwa sechzig Meter hohen Bäume, die den Wald
der Sumpfinsel ausmachten.
Motta schrie auf. Glystra schwang herum; das Blut
jagte durch seinen Körper. Eine gewaltige schwarze
Körpermasse hob sich aus dem Fluß; darüber drehte
sich ein Kopf von der Größe eines Fasses. Der Kopf
schwang herab, die Augen starrten auf einen Punkt
im Wasser, der Hals bog sich; der Kopf stieß ins Was-

ser und kehrte zurück, beladen mit einem schwam-
migen gelben Zeug, das offenbar pflanzlicher Art
war. Das Geschöpf verschlang das gelbe Zeug und
versank wieder im Fluß.
Leben kehrte auf das Floß zurück. Hysterische
Frauen ...
Glystra seufzte tief auf. »Die Griamobots existieren
offensichtlich.«
»Was ich jederzeit beschwören werde«, erklärte
Roger Fayne.
»Aber – sie sind Vegetarier. Außer Gemüse rühren
sie nichts an. Die Magicker haben dafür gesorgt, daß
man sie für fleischfressend hält; und damit konnten
sie sicher sein, daß jeder, der über den Fluß wollte,
ihre Seilbahn benutzte und dafür bezahlte ... Nun, wir
müssen weiter.«
Das Floß trieb ohne Mann und Fracht dicht am Ufer.
Die Zipangoten standen reisefertig und voll bepackt
auf dem schwammigen schwarzen Humusboden.
Glystra ging ein Stück weit in den Sumpf hinein,
um die Festigkeit des Bodens zu untersuchen. Soweit
Glystra sehen konnte, war es überall die gleiche
schwarze Torfmasse, durchzogen von flachen Was-
sertümpeln.
Er kehrte zum Fluß zurück. Die Zipangoten waren
in einer Reihe aufgestellt worden. »Gehen wir«, sagte
er.
Der Fluß fiel zurück und entzog sich verhältnismä-
ßig schnell ihrer Sicht. Die Karawane wand sich wie
eine Schlange im hohen Gras – jetzt zur Linken, jetzt
nach rechts, eine Wendung zurück, ein Stück seit-
wärts. Das war notwendig, um die Wassertümpel

und die morastigsten Stellen zu umgehen.
Die Sonne stieg, und sie ritten durch Kegel und
Streifen des grellen Tageslichts hindurch, soweit es
nicht von den dichtstehenden Mammutbäumen der
Sumpfinsel aufgefangen wurde.

10
Gegen Mittag tat sich eine helle Stelle vor ihnen auf –
ein See. Kleine Wellen warfen glitzernde Reflexe zu-
rück; Wolken bildeten sich zwischen tiefem Blau auf
der Wasserfläche ab. In der Ferne kreuzten ein paar
flache Boote mit sackartig aufgeblasenen, orangefar-
benen Segeln; und jenseits des Sees befand sich die
Sumpfstadt. Sie befand sich mitten in der Luft, war
auf den dichtstehenden Bäumen eines Waldes befe-
stigt; sie erinnerte Glystra an ein Fischerdorf der Al-
ten Welt.
Ein paar Augenblicke lang starrten sie stumm auf
die Stadt, die auf Stelzen ging ... Ein heiseres Kräch-
zen riß sie aus ihrer Versunkenheit; ein blau-gelbes
fliegendes Ding rauschte mit langsamen Flügelschlä-
gen an ihnen vorbei.
»Ich habe doch tatsächlich einen Augenblick lang
gedacht, die Magicker hätten uns eingeholt«, sagte
Fayne.
Zurück in den Wald – wieder der beschwerliche
Weg, der sie nur in schlangenförmigen Windungen
weiterbrachte; gelegentlich mußten sie sogar Stücke
des Wegs wieder zurückgehen.
Die Sonne bewegte sich über den Himmel; am
späten Nachmittag endlich sah Glystra die Mauern
und Häuser der Stadt über sich. Fünf Minuten später
bewegte sich die Karawane in den Schatten unterhalb
der Hochstadt.
»Einen Augenblick, bitte«, sagte eine gelangweilte
Stimme. Eine Gruppe von Kriegern war neben ihnen
aufgetaucht, untersetzte Männer mit maulbeerenfar-

benen Umhängen.
Der Offizier ging auf Glystra zu. »Welcher Art sind
eure Geschäfte?«
»Keine Geschäfte. Wir sind Reisende.«
»Reisende?« Der Offizier starrte auf die Zipango-
ten. »Von woher?«
»Von Jubilith, nördlich von Beaujolais.«
»Wie seid ihr mit diesen Tieren über den Fluß ge-
kommen? Gewiß nicht mit der Seilbahn; unser Agent
hätte euch angekündigt.«
»Wir haben sie mit einem Floß über den Fluß ge-
bracht. Letzte Nacht.«
Der Offizier strich sich über seinen Oberlippenbart.
»Aber haben die Griamobots –«
Claude Glystra lächelte. »Die Magicker haben ei-
nen großen Schwindel aufgezogen. Die Griamobots
sind harmlose Pflanzenfresser. Der einzig gefährliche
Griamobot war einer, den die Magicker gebaut und
mit Soldaten bemannt haben.«
Der Offizier zog hörbar seinen Atem ein. »Lord
Wittelhatch wird sich dafür interessieren. Die will-
kürlichen Bedingungen und die Tarife der Magicker
haben ihn schon lange irritiert, zumal er ihnen das
Seil geliefert hat, das sie für ihre Hochbahn brauch-
ten.«
»Das Seil interessiert mich«, bemerkte Glystra. »Ist
es aus Draht?«
»Aber nein.« Der Offizier lachte erheitert auf – ein
umgänglicher junger Mann mit einem ausdrucksvol-
len Gesicht und einem wildwuchernden, strohigen
Schnauzbart. »Kommt, ich werde euch an einen Ort
führen, wo ihr und die Tiere euch ausruhen könnt,
und entlang des Wegs werdet ihr unsere Manufaktu-

ren sehen. Wir sind die Seilmacher der Welt; nir-
gendwo gibt es Seile, die den unseren gleichkom-
men.«
Glystra zögerte. »Wir wollten unseren Weg so weit
wie möglich fortsetzen, bevor die Nacht hereinbricht.
Wenn wir die Richtung erfahren könnten –«
»Ein begüterter Mann, der es eilig hat«, erklärte der
Offizier, »sollte die Monobahn benutzen. Es dürfte
ihn eine Menge Metall kosten, sehr viel Metall ... Am
besten, ihr unterhaltet euch mit Wittelhatch.«
»Schön.« Glystra ging zur Karawane zurück; sie
folgten dem Offizier und kamen alsbald an einer An-
lage vorbei, die offenbar der Seilherstellung diente.
Ein etwa rechteckiger Platz mit einer Seitenlänge
von etwa hundertfünfzig Metern war soweit von
Bäumen befreit worden, wie es nur eben möglich
war, ohne die Abstützung der Stadt oberhalb zu be-
einträchtigen. Auf dieser Fläche waren Bahnen ange-
legt, die aus einer Aufeinanderfolge von Rahmenge-
stellen bestanden. Im Verlauf seiner Entstehung lief
das Seil jeweils durch eine Öffnung in einem Rahmen
und unmittelbar danach durch ein Rad hindurch, das
sich um das Seil als Achse herumdrehte. Das Rad war
in regelmäßigen Abständen mit Düsen versehen, von
denen aus weiße Fäden auf das Seil zuliefen. Wäh-
rend sich das Seil durch den Rahmen bewegte, ro-
tierte das Rad und führte dem Seil fünf neue Fäden
zu.
Glystra sah über die Produktionsbahnen hinweg.
Zu jedem Rahmen gehörte ein Rad, und jedes Rad
trug dem Seil fünf weitere Fäden zu. »Raffiniert«,
sagte Glystra. »Wirklich erstaunlich.«
»Unser Seil ist unübertroffen«, erklärte der Offizier

mit unverhohlenem Stolz. »Dehnbar, wetterfest,
stark. Wir liefern die Seile für die Monobahnen von
Felissima, Bogover, Thelme, für die lange Bahn nach
Grosgarth in Beaujolais und für die Bahn zum Brun-
nen am Myrtensee.«
»Hm ... und was ist eigentlich eine Monobahn?«
Der Offizier lachte. »Das sollte wohl ein Scherz
sein. Kommt, ich werde euch zu Wittelhatch bringen,
und er wird euch sicher an seinem abendlichen Gela-
ge teilnehmen lassen. Wenn ich es richtig gehört ha-
be, dann brät ein exzellenter Meeraal in seinem
Herd.«
»Aber was wird aus unserem Gepäck? Und die Zi-
pangoten, sie haben noch nichts zu Fressen bekom-
men; im Sumpf gibt es keine Nahrung für sie!«
Der Offizier gestikulierte; vier Männer traten vor.
»Füttert die Tiere gut, behandelt ihre Wunden,
wascht sie und verbindet ihre Füße.« Er wandte sich
an Glystra. »Euer Gepäck ist in sicheren Händen; die
Sumpfinsel kennt keine Diebe. Wir sind Händler und
Seilhersteller, aber keine Räuber.«
Wittelhatch war ein dicklicher Mann mit einem
runden, geröteten Gesicht. Er trug erlesene Kleider
aus den teuersten Stoffen. An jedem seiner Ohren
hing ein goldener Ring, und seine Finger waren aus-
nahmslos mit Ringen aus den verschiedensten Me-
tallen bestückt. Er saß in einem thronartigen Sessel, in
dem er sich offenbar eben erst niedergelassen hatte,
denn er mühte sich noch immer darum, daß die Fal-
ten seiner Kleidung richtig zu liegen kamen.
Der Offizier verneigte sich ehrerbietig und wies auf
Claude Glystra. »Ein Reisender aus dem Westen,
mein Lord.«

»Aus dem Westen?« Die Augen des Lords vereng-
ten sich, und er strich sich gedankenvoll über sein
Doppelkinn. »Wie mir gesagt wurde, ist das Kabel
der Seilbahn abgeschnitten worden, die über den
Fluß führte. Man wird es wieder befestigen müssen.
Wie habt ihr dann eigentlich den Fluß überquert?«
Glystra erklärte den Schwindel mit den Griamo-
bots. Wittelhatch gab seiner Wut über die Magicker
mit schrillen Tönen Ausdruck. »Diese alten Halunken
– wenn ich an all die Geschäfte denke, die ich ihnen
aus Mitgefühl vermittelt habe! Fast könnte es eine
ehrliche Gemeinschaft entmutigen, wenn sie sich in
der Nähe einer solchen Bande von Betrügern befin-
det!«
»Unser Wunsch ist es, so bald wie möglich unseren
Weg fortzusetzen«, erklärte Glystra, ohne seine Un-
geduld deutlich werden zu lassen. »Ihr Offizier hat
uns vorgeschlagen, daß wir die Monobahn benut-
zen.«
Wittelhatch wurde augenblicklich geschäftsmäßig.
»Wie groß ist eure Gruppe?«
»Wir sind acht Personen, und dazu kommt das Ge-
päck.«
Wittelhatch wandte sich an den Offizier. »Was
schlagen Sie vor, Osrik? Fünf einfache Gondeln und
eine für das Gepäck?«
Der Offizier überlegte. »Sie haben eine Menge Ge-
päck. Besser wären vielleicht zwei Gepäckgondeln
und zwei einfache. Und einen Führer, da sie die Mo-
nobahn nicht kennen.«
»Welches ist euer Ziel?« erkundigte sich Wittel-
hatch.
»Soweit östlich wie möglich.«

»Das ist der Myrtensee ... Nun ja, es macht mir we-
nig aus, meine Gondeln auf eine so weite Reise zu
schicken; ihr müßt ordentlich dafür bezahlen. Wenn
ihr die Gondeln kaufen wollt – neunzig Unzen gutes
Eisen. Wollt ihr sie aber leihweise haben – sechzig
Unzen, dazu kommt das Honorar für den Führer und
eine angemessene Gebühr für das Zurückholen der
Gondeln – sagen wir, weitere zehn Unzen.«
Glystra feilschte, bis die Leihgebühr nur noch fünf-
zig Unzen zuzüglich der Zipangoten betrug, und
Wittelhatch sich außerdem zur Bezahlung des Füh-
rers bereiterklärte. »Osrik, würden Sie es vielleicht
übernehmen wollen, diese Gruppe zu führen?«
Osrik zwirbelte an seinem blonden Schnauzer her-
um. »Es wird mir ein Vergnügen sein.«
»Gut«, sagte Glystra. »Wir brechen sofort auf.«
Der Wind blies in die Segel, und die Räder der Gon-
deln bewegten sich flüsternd am Kabel der Mo-
nobahn entlang – einem auf der Sumpfinsel herge-
stellten Seil, das einen Durchmesser von etwa andert-
halb Zentimetern hatte. Von der Sumpfstadt aus
führte die Bahn von Stützpfeiler zu Stützpfeiler über
drei Meilen Sumpfgelände auf ein zerklüftetes Vor-
gebirge zu; das Kabel hing nur knapp zwei Meter
über dem Basaltgestein und schwang dann in einer
weiten Kurve in südöstlicher Richtung. In Abständen
von etwa fünfzehn Metern wurde das Kabel von L-
förmigen Winkelstützen getragen, die auf die Pfeiler
montiert waren. Sie waren so konstruiert, daß in den
Gondeln das Passieren der Stützen kaum zu spüren
war.
Osrik reiste in der ersten Gondel, Glystra folgte als

nächster, und dann kamen die beiden dreirädrigen
Frachtgondeln, die schwer beladen waren mit Nah-
rungsmitteln, Kleidung, dem Metall, das ihren gan-
zen Reichtum darstellte, Bishopfs Vitaminpräparaten,
Faynes Campingausrüstung und allen möglichen
Dingen aus dem Gepäck der Soldaten von Beaujolais.
In der ersten Frachtgondel befanden sich Elton, Motta
und Wailie, in der zweiten Nancy, Pianza und Bis-
hop. Fayne bildete mit einer Ein-Mann-Gondel den
Schluß der Reisegesellschaft.
Während er sein eigenes Gefährt näher untersuch-
te, begann Claude Glystra zu verstehen, warum Wit-
telhatch es so offensichtlich schwerfiel, sich auch nur
vorübergehend von den Gondeln zu trennen. Das
Holz war so präzise bearbeitet und zusammengefügt
worden, daß das Gefährt mit jeder aus Metall herge-
stellten Maschine zu vergleichen war, die man in ei-
nem Laden auf der Erde kaufen konnte.
Das große Rad war aus zehn verschiedenen Holz-
streifen zusammengefügt, geleimt, genutet und abge-
schliffen. Speichen aus gehärteten Weidenruten stüt-
zen die Nabe im Mittelpunkt, deren Lager aus einem
öligen, dunklen Hartholz gearbeitet waren. Angetrie-
ben wurden die Gondeln durch Segel, die vom Sitz
der Gondel aus gehandhabt werden konnten. Außer-
dem befand sich noch eine doppelte Handkurbel in
Reichweite, deren Handgriffe wie die Pedale eines
Fahrrads entgegengesetzt angebracht waren; mit Hil-
fe dieser Kurbel konnte bei leichten Steigungen nach-
geholfen werden, wenn der Schwung und der An-
druck der Segel nicht mehr ausreichten.
Gegen Mittag veränderte sich die Landschaft unter
ihnen. Hügel und Berge machten immer wieder ein

»Umsteigen« notwendig, wobei sie die Gondeln und
das ganze Gepäck zu einem höhergelegenen neuen
Streckenbeginn transportieren mußten.
Die Nacht verbrachten sie in einer leerstehenden
Hütte nahe einer der Umsteigestellen, und am näch-
sten Morgen setzten sie ihren Weg quer durch die
Berge fort – nach Osrik war es die Bergkette von
Wicksill. Das Kabel schwang sich über Täler hinweg,
von Gipfel zu Gipfel, und manchmal befanden sie
sich mehr als fünfhundert Meter über dem Erdboden.
Das Kabel hing über einem solchen Tal natürlich
durch, und so rasten die Gondeln zunächst abwärts,
fast wie im freien Fall; zur Mitte hin nahm die Ge-
schwindigkeit ab, und der Schwung trug die Gondeln
noch weiter, bis sie verlangsamten und fast zu einem
Stillstand kamen. Zu diesem Zeitpunkt mußten die
Segel voll genutzt werden und die Handkurbeln be-
tätigt werden, und so gelang es allmählich, die Gon-
deln bis zum höchsten Punkt zu bewegen, von dem
aus das Spiel von neuem beginnen konnte.
Am Abend des dritten Tages erklärte Osrik: »Mor-
gen zu dieser Zeit werden wir in Kirstendale sein,
und ihr solltet euch durch nichts überraschen lassen,
was ihr seht.«
Glystra wollte mehr darüber in Erfahrung bringen,
aber Osrik gab außer einigen ironischen Andeutun-
gen nicht viel von sich. »Ihr werdet es schon selbst
sehen. Vielleicht werdet ihr sogar eure phantastische
Reise
aufgeben
und euch in Kirstendale niederlassen.«
»Sind die Leute etwa unfreundlich?«
»Nicht im geringsten.«
»Wer herrscht über sie? Was für eine Art von Re-
gierung haben sie?«

Osrik hob gedankenvoll die Augenbrauen. »Ich
habe niemals etwas von einem Herrscher in Kristen-
dale gehört. Ich glaube, man könnte sagen, daß sie
sich selbst regieren.«
»Wieviele Tage sind es von Kirstendale zum Brun-
nen am Myrtensee?«
»Ich habe diese Strecke noch nie bereist. Es soll
nicht sehr angenehm sein. Zu gewissen Zeiten kom-
men die Rebbirs aus den Eyriebergen herab, um die
Reisenden der Monobahn zu berauben, obwohl die
Dongmänner vom Myrtensee von den Rebbirs ab-
stammen und diesen Verbindungsweg aufrechtzuer-
halten versuchen.«
»Was liegt jenseits des Brunnens am Myrtensee?«
Osrik machte eine verachtungsvolle Geste. »Die
Wüste. Das Land der feuerfressenden Derwische und
der Vampire, wie ich gehört habe.«
»Und danach?«
»Dann kommen die Berge von Palo Malo Se und
der Blarengorran-See. Vom See aus verläuft der Fluß
Monchevior in Richtung Osten, und ihr könntet eine
beträchtliche Entfernung mit einem der Flußboote zu-
rücklegen – ich kann aber nicht sagen, wie weit, da
mir der weitere Verlauf des Flusses nicht bekannt
ist.«
Glystra stieß einen tiefen Seufzer aus. Wenn der
Fluß Monchevior sie aus dem Gesichtskreis von Osrik
tragen würde, dann blieben immer noch neunund-
dreißigtausend Meilen bis zur Erdenklave.
Während der Nacht brach ein Regensturm los, und es
gab kein Entkommen vor dem peitschenden Wind.
Die Reisenden kämpfen sich in den Windschatten ei-

nes Felsblockes und hüllten sich in ihre Decken ein,
während die Unwetterfront in Richtung Norden trieb.
Durchnäßt und frierend sahen sie eine graue
Dämmerung heraufkommen; eine Zeitlang hörte der
Regen auf, obwohl die Wolken dicht über sie hin-
wegtrieben. Sie bestiegen ihre Gondeln und setzten
nur handtuchgroße Segel; dennoch rasten sie mit sur-
renden Rädern das Kabel entlang.
Zwei Stunden lang führte die Bahn an einem Ge-
birgskamm entlang. Der Wind ließ nicht nach, und
das unter ihnen befindliche Buschwerk wurde hin-
und hergepeitscht. Zur Linken lag ein dunkles Tal,
von grauen Nebeln erfüllt; nach rechts verhinderten
die Wolken den Ausblick, aber als sie sich hoben,
wurde eine abwechslungsreiche Landschaft sichtbar –
Berge, Wälder, kleine Seen, und ein paarmal erspäh-
ten sie größere, aus Stein erbaute Burgen.
Osrik sah zu Glystra zurück, wies mit seiner Hand
auf die Landschaft zur Rechten. »Das Tal von Gala-
tudanian, und unterhalb davon das Hibernianische
Marschland. Ein Land der Grafen, Herzöge, Ritter
und Barone, die sich gegenseitig berauben ... ein ge-
fährliches Land, wenn man zu Fuß unterwegs ist.«
Der Wind nahm wieder zu. Weit zur Seite hän-
gend, rasten die Gondeln mit gut hundert Stunden-
kilometern in südöstlicher Richtung, und sie wären
noch schneller geworden, wenn Osrik nicht ständig
Luft aus seinen Segeln abgelassen hätte.
Eine Stunde lang rollten sie an dem Kabel entlang,
hin- und herschwingend, immer wieder von kleinen
Windböen erfaßt; dann erhob sich Osrik von seinem
Sitz und bedeutete den anderen, die Segel einzuho-
len.

Die Gondeln rollten auf eine Plattform, von der aus
ein Kabel im rechten Winkel zu ihrem bisherigen
Kurs in das Tal hinabführte. Der Zielpunkt war nicht
zu sehen; sichtbar war der steil abwärts geschwunge-
ne Verlauf des Kabels.
Nancy spähte hinab und wandte sich erschrocken
zurück.
Osrik lachte. »Abwärts ist es am einfachsten. Auf
dem Rückweg muß man zwei beschwerliche Tage in
Kauf nehmen, um mit dem gesamten Gepäck und
den Gondeln bis nach hier oben zu gelangen – zu
Fuß.«
»Sollen wir etwa an diesem Kabel hinabgleiten?«
fragte Nancy tonlos.
Osrik nickte.
»Wir werden in den Tod rasen; es ist so – steil!«
»Der Wind drückt dagegen, bremst den Fall der
Gondeln. Es ist nichts dabei. Folgt mir ...«
Er stieß seine Gondel ab, und einen Augenblick
später war da nur noch ein ferner, dahinschwinden-
der Umriß, hin- und hergerissen im Wind.
Claude Glystra richtete sich auf. »Ich glaube, ich
bin als nächster dran ...«
Es war wie ein Schritt ins Nichts, als würde man
mit dem Kopf voraus von einem Felsenvorsprung
springen ... Die erste Meile legte er in fast völlig frei-
em Fall zurück. Der Wind rüttelte an der Gondel,
Wolkenfetzen fegten vorbei, und die Landschaft un-
terhalb war nur ein verschwommenes Durcheinan-
der.
Das Rad über ihm sang in den höchsten Tönen,
obwohl es fast kein Gewicht trug. Das weiße Seil
führte steil abwärts ins Ungewisse.

Glystra wurde sich dessen bewußt, daß das Singen
des Rades allmählich an Tonhöhe verlor; das Seil
kurvte allmählich aus, und der Boden unter ihm kam
näher.
Er rollte über einen grün-gelben Wald hinweg, und
unterhalb erspähte er eine Siedlung aus Blockhütten,
zwischen denen Kinder in weißen Hemden herum-
sprangen und zu ihm hochsahen ... Dann waren sie
weg, und vor sich sah er eine Plattform, die im Gipfel
eines gigantischen Baumes hing. Osrik hatte diese
Plattform bereits erreicht und wartete auf ihn.
Glystra zog sich mit steifen Gliedern auf die Platt-
form. Osrik sah ihm lächelnd zu. »Wie war der
Flug?«
»Ich würde am liebsten drei volle Wochen lang mit
einer solchen Geschwindigkeit reisen. Dann wären
wir in der Erdenklave.«
Das Seil begann zu vibrieren und zu singen.
Glystra sah zurück und sah die Frachtgondel mit Sa
Elton, Motta und Wailie auf sich zukommen.
»Wir sollten uns wieder auf den Weg machen«,
sagte Osrik. »Die Plattform wird sonst noch über-
füllt.«
Die Bahn führte von Baumspitze zu Baumspitze
weiter, und manchmal streifte schwarz-grünes Blatt-
werk Glystras Füße ... Osrik hatte sein Segel eingezo-
gen, winkte ihm heftig zu.
»Was ist los?«
Osrik bedeutete ihm, sich ruhig zu halten. Er wies
nach vorn. Glystra ließ seine Gondel langsam weiter-
gleiten, bis er Osrik erreicht hatte. »Stimmt etwas
nicht?«
Osrik spähte durch einen Spalt im Blattwerk hin-

durch auf einen bestimmten Punkt auf dem Boden
unterhalb. »Dies ist ein gefährlicher Teil der Ban...
Banden von Soldaten, hungernde Waldbewohner,
Räuber ... Manchmal lauern sie darauf, daß sich eine
Gondel ziemlich hoch über dem Boden befindet,
schneiden das Seil durch und töten dadurch den Rei-
senden ...«
Glystra sah durch die Blätter hindurch Bewegung,
ein Sichverschieben von Weiß und Grau. Osrik klet-
terte von seiner Gondel aus in das Geäst des Baums
und ließ sich vorsichtig etwa einen Meter weit hinab.
Glystra beobachtete ihn schweigend. Das vibrierende
Seil verriet ihm, daß sich die nächste Gondel näherte.
Er gab das Signal zum Anhalten.
Osrik machte eine Geste. Glystra verließ seine
Gondel und kletterte zu der Astgabelung hinab, auf
der Osrik stand. Durch eine Lücke im Blattwerk
konnte er bis auf den Waldboden hinabsehen. Er sah
drei Jugendliche, die in geduckter Haltung hinter ei-
nem orangefarbenen Gebüsch lauerten. Sie hielten
Pfeile und Bogen bereit, und sie starrten zum Seil der
Monobahn hinauf, wie eine Katze ein Mauseloch be-
äugte.
»Hier bekommen sie ihr erstes Training«, wisperte
Osrik. »Wenn sie älter sind, werden sie die Dörfer des
Marschlandes und des galatudanianischen Tals über-
fallen und plündern.« Mit ruhiger Hand legte er ei-
nen Pfeil in seine Armbrust ein.
»Was hast du vor?«
»Ich werde den Größten von ihnen umbringen ...
und damit vielen unschuldigen Menschen das Leben
retten.«
Glystra riß seinen Arm hoch; der Pfeil traf nur ei-

nen Zweig über den potentiellen Attentätern. Glystra
sah ihre weißen Gesichter; dann waren sie weg, ra-
sten wie Kaninchen im Zickzack davon.
»Warum hast du das getan?« fragte Osrik aufge-
bracht. »Die gleichen Kerle werden mich auf dem
Rückweg zur Sumpfstadt vielleicht umbringen.«
Glystra fand zunächst keine Worte. Dann murmelte
er: »Tut mir leid ... ich glaube, du hast recht. Aber
wenn dies die Erde wäre, dann wären diese Burschen
noch auf der Schule.«
Die Monobahn führte aus dem Wald heraus und
abwärts, dehnte sich über ein Flußtal, über einen
schnellfließenden Fluß hinweg, den Osrik Thelma
nannte. Am entgegengesetzten Ufer wartete eine 15-
Meter-Umsteigetour auf sie, und dann setzten sie ih-
ren Weg fort durch ein Land friedlicher Farmen und
aus Stein erbauter Häusern, an denen nichts weiter
auffiel, als die Tatsache, daß sich auf dem Giebel ei-
nes jeden Hauses ein verwirrendes Durcheinander
von dornenbewehrten Zweigen und Blättern befand.
Glystra rief Osrik zu: »Was soll denn dieses dorni-
ge Zeug überall?«
»Es sind Geisterfänger!« rief Osrik zurück. »In die-
sem Teil des Landes wimmelt es nur so von Geistern;
auf jedes Haus kommt ein Geist, manchmal sogar
mehr; und da sie sich in schnellen Sprüngen fortbe-
wegen und immer auf einem Dach landen, auf dem
sie sich vor und zurück bewegen können, sind diese
Fallen aufgestellt worden, die sie fernhalten sollten
...«
Die Monobahn verlief parallel zu einem bescheide-
nen Feldweg; und dreimal passierten sie große rote
Farmkarren mit hölzernen Rädern von fast zwei Me-

tern Durchmesser, die lautstark quietschten und
ächzten. Sie waren mit einer reichen Ernte an ver-
schiedenen Früchten beladen. Die Kerle, die barfuß
daneben hergingen und die Zipangoten führten, tru-
gen große, spitz zulaufende Hüte mit Schleiern aus
weißem Leinen vor dem Gesicht.
»Um die Geister zu täuschen?« erkundigte sich
Glystra bei Osrik.
»Um die Geister zu täuschen.«
Der Nachmittag verging; das Land färbte sich all-
mählich grün, und der Boden brachte vielerlei an-
sehnliche Gewächse hervor. Das Farmland schien in
eine große Parkfläche überzugehen.
Osrik wies in die Ferne. »Wir nähern uns Kirsten-
dale, der schönsten Stadt des galatudanianischen Tals
...«

11
Zunächst war nur wenig von Kirstendale zu sehen:
weiße Schemen zwischen den Bäumen, steinerne
Mauern. Die Gondeln glitten über einem Weideland
mit rot-grünen Gräsern dahin; und endlich gaben die
Bäume den Blick frei auf die Stadt, die sich vor dem
Hintergrund blauer Berge aus einer grünen Ebene er-
hob.
Es war die größte und beeindruckendste Siedlung,
die die Männer von der Erde auf dem Großen Plane-
ten zu sehen bekamen, aber sie war mit nichts auf der
Erde zu vergleichen. Sie erinnerte Glystra an die wol-
kengeborenen Schlösser in Märchenbuchillustratio-
nen.
Die Monobahn nahm eine plötzliche Wendung,
und sie schwebten in eine Szene fröhlicher Aktivitä-
ten und karnevalesker Farben hinein.
Ein Spiel war im Gange. Fünfzig Männer und
Frauen in elegantester Kleidung hatten sich auf dem
Feld aufgestellt. Das Feld war in Quadrate unterteilt
durch Linien verschiedenfarbigen Grases, das mit
großer Sorgfalt geschnitten und gepflegt war. Jeder
Spieler hatte eines dieser Quadrate besetzt. Von Bal-
lons, die mit Schnüren am Boden festgemacht waren,
hingen Seidenbanner herab, und jedes dieser Banner
leuchtete in einer anderen Farbe: seegrün, blau, pfir-
sichfarben, orange. Eine Unzahl von kleinen farbigen
Bällen flogen hin und her. Die Bälle schienen so leicht
zu sein, daß sie mühelos durch die Luft schwebten.
Das Auffangen der Bälle schien nach bestimmten
Regeln zu erfolgen, die von der Farbe des Balles, des

Feldes und des Kopfbandes des jeweiligen Spielers
abhingen. Es wimmelte nur so von Bällen über dem
Spielfeld. Gelegentlich fing ein Spieler mehrere Bälle
gleichzeitig auf und gab sie geschickt weiter. Traf ein
Ball eines der Banner, so brachen die Zuschauer in
lautstarken Jubel aus.
Es waren einige hundert Personen, die dem Spiel
zusahen; und ein jeder von ihnen trug eine extrava-
gante Garderobe, auf deren Zusammenstellung of-
fenbar größte Fantasie verwandt worden war.
Die Monobahn umlief das Feld. Spieler und Zu-
schauer sahen nur kurz auf und wandten sich wieder
ihrem Spiel zu. Glystra erspähte einen Diener, der ei-
nen kleinen Wagen mit Süßigkeiten vor sich her-
schob. Der Diener trug einen klassischen Frack.
Glystras Gondel glitt langsam am Kabel entlang.
Die Frachtgondel mit Pianza und Bishop folgte dicht
dahinter.
»Steve!« rief Glystra nach hinten. »Was steht in
deinem Almanach über Kirstendale?«
»Ich bringe es nicht mehr ganz zusammen. Es gibt
da also einen Begriff, das Paradoxon von Kirstendale.
Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Stadt wurde
von einem Syndikat von Millionären begründet, die
zum Großen Planeten auswanderten, um den Steuer-
sätzen der Erde zu entgehen. Ursprünglich waren es
zwanzig oder dreißig Familien, die sich mitsamt ihrer
Dienerschaft hier ansiedelten. Nun – das hier scheint
das Ergebnis davon zu sein.«
Die Gondeln folgten einer weiteren Biegung und
glitten unter einem Torbogen hindurch in die Stadt
hinein. Am Endpunkt der Bahn wurden sie von drei
schweigsamen, livrierten Dienern empfangen, die ihr

Gepäck übernahmen und auf mehrere hochrädrige
Karren luden. »Was soll das?« wandte sich Glystra an
Osrik.
»Sie gehen davon aus, daß wir reich sind.«
»Dann wollen sie womöglich auch noch Trinkgeld
haben?«
»Sie hätten sicher nichts dagegen.«
Der Chefdiener trat auf sie zu. Er trug einen sorg-
fältig gepflegten Backenbart und die seiner Stellung
entsprechende gewichtige Miene.
Glystra gab ihm drei kleine Eisenmuttern. »Für Sie
und Ihre Leute.«
»Ich danke Ihnen sehr. Wohin darf ich Ihr Gepäck
senden lassen?«
»Was können Sie uns empfehlen?«
»Da gibt es zunächst das Grand Savoyard, das
Hotel Metropol und das Ritz-Carlton – alle in der
gleichen Preislage, alle sehr zu empfehlen.«
»In welcher Preislage?«
»Eine Unze pro Woche. Das Traveller's Inn und das
Fairmont sind gleich teuer, aber ruhiger.«
»Können Sie mir eine gute Unterkunft in mäßiger
Preislage nennen?«
»Ich empfehle den Hunt Club. Wenn Sie bitte die
Kutsche benutzen wollen, Sir ...«
Er führte sie zu einer Kutsche, die reichlich mit
Gold verziert war. Es waren jedoch keine Tiere da-
vorgespannt, und es waren auch weit und breit keine
Zipangoten zu sehen. Zögernd nahmen sie in der
Kutsche Platz.
Der Chefdiener schloß die Tür und gab ein Zei-
chen. Vier Männer in engen schwarzen Uniformen er-
schienen. Jeder von ihnen nahm ein Zugseil über die

Schulter, und der Wagen setzte sich in Bewegung.
Kirstendale war eine helle, saubere und geradezu
glänzende Stadt. Überall erhoben sich Türme, an de-
nen sich spiralenförmige Treppen hochrankten, die
zum zwiebelförmigen Wohnteil auf der Turmspitze
führten. Sie näherten sich einem merkwürdigen
Rundbau in der Mitte der Stadt, einem schwerfälligen
Gebäude, dem Reihen von großen Fenstern den Ein-
druck von Licht und Eleganz verliehen.
Sie fuhren unter einer Überdachung aus bunten
Glasfenstern hindurch, in denen sich die Nachmit-
tagssonne kaleidoskopartig spiegelte. Große Lettern
an der Überdachung besagten: »Hotel Metropol«.
Der Wagen setzte seinen Weg um das Gebäude
herum fort und fuhr unter einer weiteren Überda-
chung hindurch, die diesmal mit dunkelrotem Satin
und goldenen Quasten drapiert war. Ein Schild ver-
riet, daß es sich um das Grand Savoyard handelte.
Als nächstes kamen sie an einer fast klassisch an-
mutenden Pforte vorüber, die durch große, eingemei-
ßelte Buchstaben als Pforte des »Ritz-Carlton« aus-
gewiesen wurde.
Sie passierten die orientalisch wirkende Fassade
des Traveller's Inn und erreichten endlich den Hunt
Club.
Ein Portier kam ihnen entgegen, öffnete den Schlag
der Kutsche und eilte ihnen voraus, um die Ein-
gangstür für sie aufzuhalten. Ein kurzer Korridor
führte zum Empfangsraum.
Glystra sah sich um und bemerkte, daß Flure aus
verschiedenen Richtungen in diesem zentral gelege-
nen Empfangsraum wie die Speichen eines Rades zu-
sammenliefen. Er tauschte einen Blick mit Pianza und

grinste. »Hotel Metropol, Grand Savoyard, Ritz-
Charlton, Traveller's Inn, Hunt Club – das ist alles ein
und dasselbe, es sind nur verschiedene Eingänge ins
gleiche Haus.«
Osrik bedeutete Glystra, diese Erkenntnis nun für
sich zu behalten. »Leise. Für die Leute von Kirsten-
dale ist das hier Wirklichkeit, sie nehmen es sehr
ernst. Sie würden sich sehr verletzt fühlen, wenn sie
so etwas zu hören bekommen.«
»Aber ...«
Osrik sprach leise und schnell. »Ich hätte es euch
doch sagen sollen. Der Eingang, den man benutzt, be-
stimmt den Rang, den man in der Gesellschaft von
Kirstendale einnimmt. Geboten wird zwar das glei-
che, aber es ist im allgemeinen vorteilhafter, durch
das Metropol zu kommen.«
Glystra nickte. »Jetzt verstehe ich. Wir werden in
Zukunft aufpassen, daß wir es besser machen.«
Der Portier führte sie durch die Halle hindurch zu
einem halbrunden Empfang. Ein genau abgegrenzter
Teil des Empfangstisches war mit den Farben des
Hunt Club geschmückt.
»Sie sind Mr. Claude Glystra vom Planeten Erde?«
erkundigte sich der Empfangsangestellte.
Glystra wandte sich erstaunt um.
»Warum fragen Sie?«
»Ich darf Ihnen ausrichten, daß Sir Walden Mar-
chion Sie aufs herzlichste grüßen läßt und an Sie und
Ihre Gesellschaft die Bitte richtet, während Ihres Auf-
enthaltes mit seiner Villa vorlieb zu nehmen. Er hat
bereits eine Kutsche bereitstellen lassen für den Fall,
daß Sie seine Einladung annehmen.«
Glystra wandte sich ungerührt an Osrik. »Wie kann

dieser Sir Walden Marchion von unserer Ankunft er-
fahren haben?«
»Der Chefdiener an der Monobahnstation hat sich
nach unserer Herkunft erkundigt. Ich habe keinen
Grund gesehen, sie zu verschweigen.«
»Neuigkeiten scheinen sich hier ja schnell herum-
zusprechen. Was ist von dieser Einladung zu halten?«
Osrik wandte sich an den Empfangsangestellten.
»Können Sie uns bitte sagen, wer Sir Walden Mar-
chion ist?«
»Es ist einer der wohlhabendsten und bedeutend-
sten Männer von Kirstendale. Ein großzügiger Herr,
an dessen Tafel sogar häufig Fleisch gereicht wird.«
»Dann sehe ich keinen Grund, die Einladung ab-
zulehnen«, wandte sich Osrik an Glystra.
»Wir nehmen die Einladung an.«
Der Empfangsangestellte nickte. »Ich bin über-
zeugt, daß Sie einen angenehmen Aufenthalt haben
werden. Die Kutsche wartet auf Sie.«
Sie verließen den Empfangsraum, wobei sie darauf
achteten, daß sie auch wirklich den Ausgang des
Hunt Club und keinen anderen benutzten, und stie-
gen draußen in die wartende Kutsche.
»Ihr Gepäck wird Ihnen umgehend nachgesandt
werden«, verabschiedete sich der Empfangsange-
stellte.
»Diese Leute hier sind wirklich sehr reizend und
zuvorkommend«, erklärte Pianza.
Fayne ließ sich mit einem tiefen Seufzer in die Pol-
ster fallen. »Ein feudalistisches System hat durchaus
seine Annehmlichkeiten, jedenfalls solange man zu
den Bedienten gehört.«
»Ich frage mich«, setzt Glystra an, während er aus

den Fenster blickte, »was es mit dieser Äußerung des
Empfangsangestellten auf sich hat, daß bei Sir Wal-
den häufig Fleisch gereicht wird.«
»Das ist leicht zu erklären«, sagte Osrik. »Es gibt im
ganzen galatudanianischen Tal kein Fleisch außer
dem der Zipangoten, welches jedoch ungenießbar ist.
Daran ist ein Insekt schuld, das alle Tiere außer den
Zipangoten zum Aussterben gebracht hat. Die Leute
hier ernähren sich daher nur von Gemüse und
Früchten; nur selten und zu besonderen Anlässen
wird aus Coelanvilli Fleisch eingeführt.«
Die Kutsche, von fünf Bediensteten Sir Waldens
gezogen, bewegte sich durch eine Art von Ladenstra-
ße, deren bunte Auslagen von scheinbar großem
Wohlstand zeugten.
»Ich frage mich nur«, begann Fayne, »was ist das
für eine Wirtschaft, die das alles hier möglich macht?
Irgendwo müssen doch all diese Güter hergestellt
werden. Aber wo? Und von wem? Von Sklaven?«
»Das kann ich mir auch nicht recht vorstellen«,
meinte Glystra. »Sie müssen eine beträchtliche eigene
Produktion haben. Sicher werden sie nicht von der
Erde aus versorgt.«
»Die Leute von Kirstendale haben ein Geheimnis«,
stellte Pianza fest.
»Was immer es auch sein mag«, bemerkte Fayne
mit einer abschließenden Bewegung, »es scheint ei-
nem jeden zuzusagen. Alle sind glücklich hier.«
»Alle, die wir zu sehen bekommen«, schränkte El-
ton ein.

12
Die Kutsche hielt an, und ein grünlivrierter Diener
öffnete den Schlag. »Das Kastell von Sir Walden Mar-
chion!«
Sie verließen die Kutsche und gingen die Stufen
hinauf, die spiralförmig zu Sir Waldens Wohnung
führten. Als sie oben angelangt waren, stieß der Die-
ner die breite Eingangstür auf und trat beiseite. Die
Gäste Sir Waldens betraten das Luftschloß.
Sie befanden sich in einem weiten Raum, dessen
Boden nicht eben war, sondern sich zur Mitte hin
senkte, wo ein kleiner Teich mit blauschimmerndem
Wasser angelegt worden war.
»Sie mögen es sich bequem machen«, erklärte der
Diener. »Sir Walden ist nach hier unterwegs, um Sie
zu begrüßen. Es stehen Erfrischungen zu Ihrer Verfü-
gung.«
Fünf Minuten später erschien Sir Walden – hoch-
gewachsen, mit ernstem Blick, aber durchaus sym-
pathisch. Er bat um Entschuldigung, da Geschäfte ihn
abgehalten hätten, sie eher zu begrüßen.
Sowie Glystra eine Gelegenheit dazu fand, wandte
er sich verstohlen an Pianza und fragte flüsternd:
»Haben wir den nicht schon einmal gesehen?«
»Ich kann mich nicht daran erinnern«, gab Pianza
mit einem Kopfschütteln zurück.
Zwei Jungen im Alter von vierzehn und sechzehn
Jahren traten ein. »Meine Söhne Thane und Halmon«,
stellte Sir Walden vor.
Glystra ergriff das Wort. »Wir freuen uns aufrichtig
über Ihre Gastfreundschaft, Sir Walden, aber darf ich

mir die Frage gestatten, wie wir zu dieser Ehre kom-
men, da wir Ihnen doch völlig unbekannt sind?«
Sir Walden wich mit einer graziösen Geste aus.
»Aber ich bitte Sie. Wir werden gewiß noch genug
Zeit haben, um uns eingehend zu unterhalten. Sie ha-
ben eine beschwerliche Reise hinter sich, und Sie
werden sich erfrischen wollen.« Er klatschte in die
Hände.
Ein gutes Dutzend Bedienstete erschienen, Männer
und Frauen. »Bäder für die Herrschaften, angerei-
chert mit ... hm, mit Nigali neunundzwanzig ... ja, das
wird das beste sein. Und dann bitte neue Kleider für
unsere Gäste.«
»Wir danken Ihnen«, erklärte Glystra. Sir Waldens
Gastfreundschaft war ihm noch immer ein Rätsel.
Er wurde in einen höhergelegenen Raum geführt.
Ein junger Mann in schwarzer Livree nahm seine
Kleider entgegen. »Durch diese Tür bitte, Lord
Glystra.«
Er trat in einen kleinen Raum mit perlmuttbesetz-
ten Wänden. Wasser stieg langsam höher, bis zu sei-
nen Knien, zur Hüfte und zur Brust. Schaum und Sei-
fenblasen bildeten sich auf der Wasseroberfläche.
Glystra dehnte und reckte sich, und ein Gefühl von
Entspannung überkam ihn.
Der
Wasserspiegel
sank
schnell
wieder
ab,
und
war-
me Luft hüllte seinen Körper ein. Er öffnete die Tür.
Anstelle des livrierten Dieners erwartete ihn jetzt
ein Mädchen, das ihm mit ausgestreckten Armen ein
Handtuch entgegenhielt.
»Ich bin Ihre Kammerdienerin. Wenn Sie es aller-
dings wünschen sollten, werde ich das Zimmer ver-
lassen.«
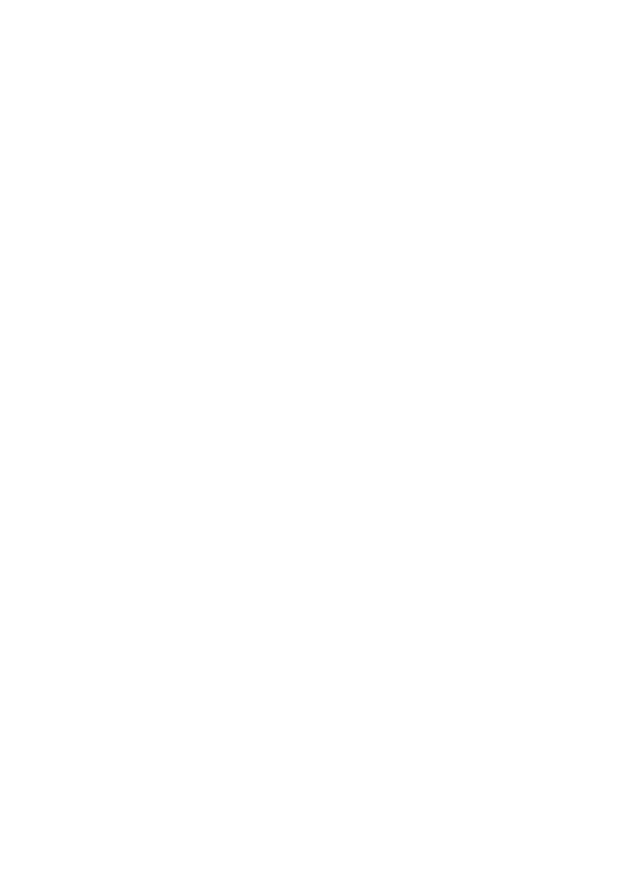
Sie machte kehrt und kam mit einer Kollektion der
landesüblichen Kleidung zurück. Glystra mußte sich
von ihr helfen lassen, um sich in die vollkommen un-
gewohnten Kleidungsstücke hineinzuzwängen.
Schließlich trat sie ein paar Schritte zurück und er-
klärte: »Jetzt ist mein Lord ein Lord unter seinesglei-
chen.«
Glystra kam sich eher lächerlich vor. Er trug Klei-
dung aus grünem und blauem Satin und ein schwar-
zes Barett als Kopfbedeckung.
Er begab sich in die Empfangshalle hinab, in der
ein Tisch hergerichtet worden war – mit Gedecken
für vierzehn Personen. Das Geschirr war aus dün-
nem, geschliffenem Marmor; das Besteck war aus ei-
nem harten Holz geschnitzt.
Einer nach dem anderen erschien. Die Männer von
der Erde kamen sich offenbar alle etwas komisch vor,
während sich die Mädchen in ihrem neuen Glanz
durchaus wohlzufühlen schienen. Nancy betrat den
Raum, ohne Glystra auch nur eines Blickes zu würdi-
gen.
Sir Walden erschien in Begleitung einer hochge-
wachsenen Dame, die er als seine Frau vorstellte. Mit
ihnen traten seine beiden Söhne und eine Tochter ein.
Das Essen war ein wirklicher Genuß, und ein Gang
folgte dem anderen. Es waren Leckerbissen einer
fremdartigen Geschmacksrichtung, aber sie munde-
ten durchwegs gut und waren appetitlich serviert.
Obwohl es vegetarisch war, war es erstaunlich viel-
seitig auch im Geschmack. Feine Liköre rundeten die
Mahlzeit ab, und allmählich kam das Gespräch in
Gang.
»Sir, Sie haben uns immer noch nicht gesagt, war-

um Ihr Interesse an uns so groß ist, da wir doch nur
zufällig durchreisen.«
»Aber das liegt doch auf der Hand«, meinte Sir
Walden lächelnd. »Sie kommen von der Erde. Seit
fünfzig Jahren ist kein Erdenbewohner mehr durch
Kirstendale gekommen. Ihre Anwesenheit in meinem
Haus ist mir nicht nur eine angenehme Abwechslung,
sondern trägt auch zu meinem Einfluß in der Stadt
bei. Wie Sie sehen, bin ich ganz offen zu Ihnen, ob-
wohl das vielleicht zu meinem Nachteil sein könnte.«
»Ich verstehe«, sagte Glystra.
»Ich war mit meiner Einladung besonders schnell«,
fuhr Sir Walden fort. »Zweifellos hätten Sie innerhalb
von einer Stunde noch eine ganze Anzahl weiterer
Einladungen bekommen. Aber ich habe eben die be-
sten Verbindungen zur Dienerschaft an der Mo-
nobahnstation. Vielleicht erklärt sich dadurch man-
ches.«
Der Abend ging langsam dahin. Glystra zog sich
frühzeitig auf sein Zimmer zurück – mit einem
schweren Kopf, was offenbar von den unbekannten
Weinen herrührte.
Am nächsten Morgen half Glystra ein hagerer jun-
ger Mann beim Ankleiden, der seiner Tätigkeit ziem-
lich schweigsam nachging.
In der Halle traf er wieder die anderen, nur Nancy
und Fayne fehlten noch. Kurz darauf kam Nancy,
und sie erschien Glystra schöner als je zuvor. Zu-
gleich wirkte sie in einem gewissen Maße kühl und
unnahbar.
»Wo ist Roger?« fragte Pianza. »Ob der heute über-
haupt nicht aufstehen will?« Er wandte sich an einen
Diener. »Würden Sie bitte Mr. Fayne wecken?«

Der Diener kam zurück. »Mr. Fayne hält sich nicht
in seinem Zimmer auf.«
Sie bekamen Fayne den ganzen Tag über nicht
mehr zu Gesicht.
»Vielleicht hat er sich zu Fuß aufgemacht, die Stadt
näher in Augenschein zu nehmen«, mutmaßte Sir
Walden, und Glystra stimmte ihm wider Willen zu,
da er keine andere Antwort zu geben wußte. Hatte
Fayne sich aus eigenem Antrieb für ein paar Stunden
abgesetzt, dann würden sie ihn bald wieder zu sehen
bekommen. War er aber gezwungen worden, dann
ließ sich im Augenblick nichts unternehmen. Am be-
sten war es vielleicht, Kirstendale so schnell wie
möglich wieder zu verlassen.
Wailie und Motta waren da anderer Ansicht. »Wir
würden so gerne hierbleiben«, erklärte Wailie. »Hier
sind alle froh und zufrieden; niemand schlägt seine
Frau, und es gibt genug zu essen für alle.«
»Es gibt zwar kein Fleisch hier«, ergänzte Motta,
»aber ist das so wichtig? Dafür gibt es andere Dinge,
zum Beispiel all die schönen Kleider, das parfümierte
Wasser und –« Sie brach ab, sah Wailie an und ki-
cherte. Dann sahen die Mädchen Elton und Bishop
an, und sie kicherten beide.
Steve Bishopf errötete und beschäftigte sich mit
dem grünen Fruchtsaft, der vor ihm stand. Elton zog
die Augenbrauen hoch.
»Ich darf Ihnen eine angenehme Überraschung an-
kündigen«, vermeldete Sir Walden. »Heute abend
wird Fleisch serviert werden – eine Mahlzeit, die Ih-
nen zu Ehren zubereitet wird.«
Lächelnd sah er sie nacheinander an, suchte in ih-
ren Gesichtern nach der erwarteten Begeisterung.

»Aber vielleicht bedeutet Ihnen das nicht soviel wie
uns hier in Kirstendale. Im übrigen darf ich Ihnen
noch eine Einladung von Lord Sir Clarence Attlewee
übermitteln, der sich überglücklich schätzen würde,
wenn er Sie bei einer Abendgesellschaft zu Ihren Eh-
ren begrüßen dürfte. Er hofft auf Ihre Zusage.«
»Ich danke Ihnen«, erklärte Glystra. »Ich freue
mich über diese Einladung.« Er sah seine Begleiter an.
»Und ich glaube, das schließt uns alle hier ein, auch
Fayne, wenn er bis dahin wieder zurück sein sollte.«

13
Sie unternahmen einen ausgedehnten Nachmittags-
spaziergang. Als sie wieder in Sir Waldens Kastell zu-
rückkehrten, war Fayne noch immer nicht wieder
aufgetaucht.
Sir Walden selbst war noch aufmerksamer und zu-
vorkommender als zuvor. Er servierte das Fleisch
selbst. Es waren Scheiben eines sehr hellen Bratens in
brauner Soße. Glystra, der bereits von den anderen
Gängen reichlich zu sich genommen hatte, aß davon
nur, um dem Gastgeber gegenüber nicht unhöflich zu
sein. »Von was für einem Tier stammt dieses Fleisch
eigentlich?«
Sir Walden wischte sich den Mund mit einer Servi-
ette ab. »Ein großes Tier, das auch in der ganzen Um-
gegend selten vorkommt. Es scheint vereinzelt vom
Norden her einzuwandern; wir konnten das Fleisch
nur durch einen großen Glückszufall bekommen.«
»Es schmeckt wirklich ausgezeichnet.« Glystra sah
sich in der Runde um und stellte fest, daß sich die
anderen mit großem Appetit über das Essen herge-
macht hatten.
Der Nachtisch wurde serviert. »Ich glaube, wir
werden Kirstendale morgen wieder verlassen«, sagte
Glystra.
»So früh schon?«
»Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und
die Monobahn kann uns nur noch ein verhältnismä-
ßig kleines Stück weiterbringen.«
»Aber Ihr Freund Fayne? Was wird aus ihm?«
»Er wird uns leichthin einholen können, wenn er
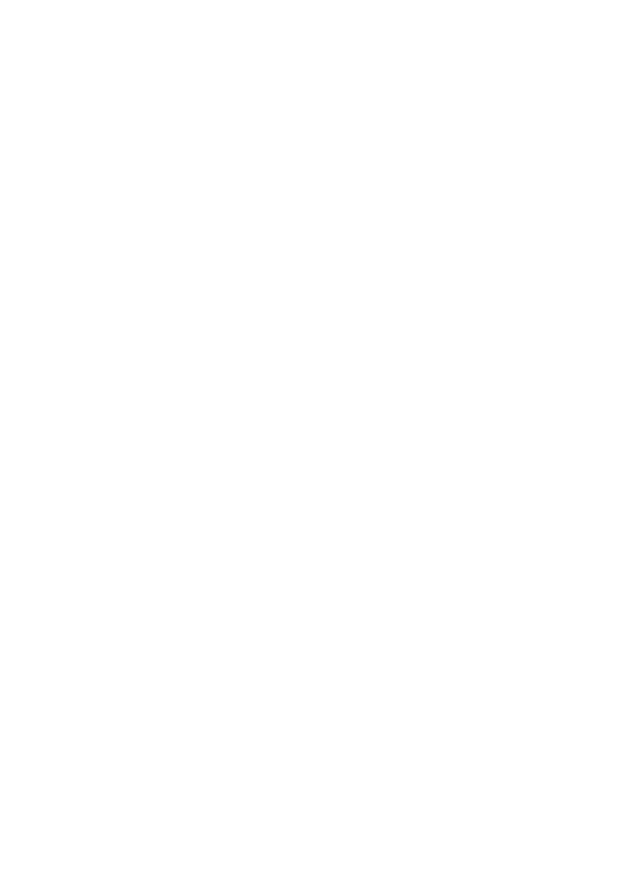
wieder auftaucht.«
»Wir werden hier in Hinsicht auf die schwere Rei-
se, die uns bevorsteht, zu sehr verwöhnt«, erklärte
Pianza. »Noch eine Woche, und ich könnte mich
vielleicht schon nicht mehr zur Weiterreise aufraf-
fen.«
Sir Walden erklärte sein Bedauern. »Ich habe Sie
gewissermaßen aus Neugier eingeladen. Inzwischen
betrachte ich Sie aber als Freunde.«
Eine Kutsche fuhr vor, um sie zur Abendgesell-
schaft bei Sir Attlewee abzuholen. Sir Walden blieb
zurück.
»Wollen Sie uns nicht begleiten?«
»Bedaure sehr, meine Herrschaften, aber ich bin
heute abend anderweitig verpflichtet.«
Glystra ließ sich in die Polster sinken. Er fühlte
nach seiner Seite, aber dann fiel ihm ein, daß er die
Waffe in seinem Zimmer gelassen hatte. »Wir sollten
heute abend nicht zuviel trinken«, flüsterte er Elton
zu. »Ich weiß nicht, warum, aber ich habe so ein ko-
misches Gefühl. Es ist vielleicht besser, wenn wir kla-
re Köpfe behalten.«
»In Ordnung.«
Die Kutsche hielt, und sie wurden eine Spiraltreppe
hinaufgeführt. Auf der obersten Treppenstufe er-
wartete sie Sir Clarence. Glystra starrte ihn an. Er war
sich dessen sicher, daß er Sir Clarence schon einmal
gesehen hatte. »Entschuldigen Sie, aber sind wir nicht
schon einmal zusammengetroffen, Sir Clarence?
Vielleicht heute nachmittag, während unseres Spa-
ziergangs?«
»Das glaube ich nicht«, erwiderte Sir Clarence be-
stimmt. »Ich war anderweitig beschäftigt.« Er führte

sie ins Haus hinein. »Gestatten Sie, daß ich Ihnen
meine Frau vorstelle. Und das ist Valery, meine
Tochter.«
Glystra brachte vor Erstaunen den Mund nicht
mehr zu. Es war das Mädchen, das seine Kammer-
dienerin gespielt hatte. »Es freut mich, Ihre Bekannt-
schaft zu machen«, brachte er schließlich hervor.
Bishop wandte sich ihm unauffällig zu. »Das ist
merkwürdig ...«
»Was?«
»Ich bin sicher, daß ich diesen Sir Clarence schon
einmal gesehen habe.«
»Ich ebenfalls.«
Steve Bishop schnippte mit den Fingern. »Ja, ich
hab's.«
»Wer ist es?«
»Sir Clarence ist oder war der Eingangsportier des
Hunt Club.«
Clystra starrte erst Bishop und dann Sir Clarence
an, der sich gerade mit Nancy unterhielt. Bishop hatte
recht.
Hinter sich vernahm er ein lautes Auflachen. »Seht
euch das mal an!«
Es war Elton, und er gehörte zu den Leuten, die
selten genug lachten. Glystra wandte sich um und
sah sich Roger Fayne gegenüber.
Fayne trug eine schwarze Livree mit kleinen Gold-
pauletten an den Schultern. Er schob einen kleinen
Wagen vor sich her.
Glystra, Pianza und Bishopf brachen zusammen in
lautes Gelächter aus. Faynes Gesicht überzog sich mit
einer feinen Röte. Er warf Sir Clarence einen flehen-
den Blick zu, während dieser ungehalten herübersah.

»Nun, Fayne«, sagte Glystra, »ich glaube doch, daß
du uns eine Erklärung schuldig bist. Du hast dir of-
fenbar während unseres Aufenthaltes hier eine kleine
Nebenbeschäftigung gesucht?«
»Wünschen Sie Erfrischungen, meine Herren?«
fragte Fayne mit tonloser Stimme.
»Keine Erfrischungen! Eine Erklärung wollen wir.«
»Danke sehr, der Herr.« Er schob seinen Wagen
weiter.
Glystra ging hinter Fayne her, der offenbar den
Wagen aus dem Zimmer hinausrollen wollte. »Roger,
du sagst mir jetzt endlich, was hier gespielt wird!«
»Nicht so laut!« flüsterte Fayne. »Es ist ungehörig,
einen solchen Auftritt zu inszenieren.«
»Ich bin eben kein geborener Aristokrat.«
»Aber ich bin es, und Sie verletzen meine Grund-
sätze.«
Glystra mußte sich beherrschen, um nicht wieder
in lautes Lachen auszubrechen. »Aristokrat? Grund-
sätze? Du bist doch bloß ein Schuhputzer, der einen
Karren durch die Gegend schiebt!«
»Hier ist jeder nicht mehr und nicht weniger«, gab
Fayne zurück. »Jeder ist jedermanns Diener. Wie
sonst sollten sie sonst den Schein aufrechterhalten?«
»Aber ...« Glystra setzte sich.
»Ich habe mich entschieden. Mir gefällt es hier.
Und ich habe genug von deiner Vierzigtausend-
Kilometer-Reise, bei der doch keiner lebend ans Ziel
kommt. Ich habe Sir Walden gefragt, ob ich bleiben
könnte. Er hat zugesagt, mich aber darauf hingewie-
sen, daß ich wie jeder andere hier auch zu arbeiten
hätte. Es gibt vermutlich nirgendwo arbeitsarmere
Menschen als die Leute von Kirstendale. Sie wissen,

was sie wollen, und dafür arbeiten sie. Für jede Stun-
de sorglosen Lebens als Aristokrat arbeiten sie zwei
Stunden anderweitig – in Verkaufsläden, Fabriken
oder zu Hause. Meist in allen drei Bereichen. Statt nur
ein Leben zu leben, leben sie drei. Es geht ihnen gut
dabei, und sie lieben es. Ich liebe es ebenfalls. Und
wenn du mich einen Snob nennst.« Und mit wüten-
der Stimme setzte er hinzu: »Aber während ihr drau-
ßen im Dreck kampiert, lebe ich hier wie ein König!«
»Das ist schon in Ordnung«, erklärte Glystra ruhig.
»Oder sollte ich vielleicht Sir Roger sagen? Nur, war-
um hast du uns nichts von deinen Absichten er-
zählt?«
»Ich habe befürchtet, es gäbe eine Auseinanderset-
zung mit dir.«
»Aber ich bitte dich. Du bist ein freier Mensch.« Er
wandte sich ab. »Ich wünsche dir alles Gute.« Damit
kehrte er in die Halle zurück.
Am nächsten Morgen holte sie eine Kutsche von Sir
Waldens Kastell ab. Unter den Männern, die das Ge-
fährt zogen, befand sich einer der Söhne von Sir Cla-
rence. Wailie und Motta waren nicht zu sehen.
Glystra wandte sich an Elton und Bishop. »Wo sind
denn eure liebreizenden Dienerinnen?«
Bishop zuckte mit den Schultern.
»Sie wissen doch, daß wir jetzt abfahren wollen?«
»Natürlich.«
»Es ist besser, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen«,
erklärte Elton grinsend. »Wir können mit Kirstendale
nicht konkurrieren.«
»Gehen wir«, sagte Bishop.
»Hier sind sie auf jeden Fall besser aufgehoben«,
fügte Elton hinzu.

An der Monobahnstation öffnete der Portier den
Wagenschlag und kümmerte sich um ihr Gepäck.
Claude Glystra gab seinen Begleitern ein Zeichen. Der
Portier war niemand anders als Sir Walden.
Mit unbewegter Miene überreichte Glystra ihrem
vormaligen Gastgeber drei Eisenschrauben als Trink-
geld. Sir Walden Marchion verbeugte sich tief. »Ich
danke Ihnen sehr, mein Herr.«
Kirstendale verschwand im Westen. Osrik hatte wie-
der die Spitze inne, Glystra folgte in der zweiten
Gondel. Dann kam eine Frachtgondel mit Nancy und
Elton, den Schluß bildeten Bishop und Pianza.
Glystra dachte an die vergangenen Wochen zurück.
Ketch, Darrot und Vallusser waren tot. Fayne hatte
sie verlassen. Wer würde der nächste sein?
Ihre Fahrt ging zunächst an einem ruhig dahinflie-
ßenden Fluß entlang. Als der Fluß sich nach Norden
wandte, während die Monobahn in östlicher Rich-
tung weiterführte, breitete sich unvermittelt die trok-
kene Savanne unter ihnen aus.
Am Abend des dritten Tages erreichten sie den
Pellitante-See. Am späten Abend fuhren sie noch
immer am Ufer entlang. Zu ihrer Rechten erstreckte
sich der weite See. Am Horizont waren die Segel von
einigen Booten zu erkennen. Ihre Insassen, erklärte
Osrik, setzten während ihres ganzen Lebens nie einen
Fuß an Land und ernährten sich ausschließlich vom
Fischfang.
Es dämmerte bereits, als ihnen Gondeln aus der
entgegengesetzten Richtung entgegenkamen, die mit
einer größeren Gruppe von Händlern besetzt war.
Osrik brachte seine Gondel zum Stehen und tauschte

mit dem Sprecher der sich nähernden Gruppe Begrü-
ßungen aus.
Die Händler stammten aus Miramar in Coelanvilli,
südlich von Kirstendale gelegen, und kehrten vom
Myrtensee zurück. Sie waren in helle Leinenanzüge
gekleidet, und rote Tücher um den Kopf verliehen
ihnen ein piratenähnliches Aussehen. Osrik schien je-
doch völlig unbesorgt zu sein, so daß auch Glystra
seine Befürchtungen beiseiteschob.
Die Kolonne bestand aus zehn Frachtgondeln, mit
Kristallzucker beladen. Nach einem ungeschriebenen
Gesetz mußten die Männer von der Erde, da sie in
der Minderzahl waren, ihre Gondeln vom Kabel ab-
hängen und der anderen Gruppe das Vorrecht lassen.
Da es bereits dunkel wurde, entschied sich Glystra
zum Lagern. Die Händler wollten ebenfalls nicht
mehr weiterfahren.
»Wir leben in schlechten Zeiten«, erklärte der An-
führer der Händler. »Alles ist gegen die Händler. Es
ist gut, wenn sich viele ehrliche Hände zum gegen-
seitigen Schutze verbinden.«

14
Es
war
noch
zu
früh
zum
Schlafen.
Die
Händler
grup-
pierten sich um ein Feuer herum und widmeten sich
einem Spiel. Osrik schmierte, leise durch die Zähne
pfeifend, die Lager der Wagen ab, und die anderen
waren mit sich selbst beschäftigt. Glystra ging zum
See hinab und sah dem Sonnenuntergang zu. Nancy
folgte ihm.
»Warum bist du hierhergegangen?« fragte sie.
»Ach, ich bin gegangen und war dabei ganz in Ge-
danken versunken. Tut es dir leid, daß wir Kirsten-
dale verlassen haben?«
Ihre Antwort erstaunte ihn. »Natürlich nicht.« Und
nach einer Weile setzte sie hinzu: »Du hast es ver-
mieden, mir auch nur ein Wort zu schenken.«
»Wie kommst du darauf?« Glystra hatte das unan-
genehme Gefühl, daß er in die Verteidigung getrieben
wurde.
»Vielleicht fandest du die Frauen von Kirstendale
begehrenswerter als mich.« Eine Spur von Bitterkeit
schwang in ihren Worten mit.
»Aber ich habe doch mit kaum einer gesprochen«,
lachte Glystra. »Wie haben dir denn die Männer in
Kirstendale gefallen?«
Sie näherte sich ihm. »Ich hätte niemals an einen
anderen als dich denken können. Wenn du nur wüß-
test, wie mich die Eifersucht gequält hat.«
Sie ließen sich auf einem Baumstamm nieder.
Glystra mußte sich eingestehen, daß er doch unge-
mein erleichtert war.
»Nach dem Myrtensee werden wir nicht mehr so

leicht vorankommen.«
»Ich weiß.«
»Ich habe schon überlegt, ob wir nicht nach Kir-
stendale zurückgehen sollten, um ein Segelflugzeug
zu bauen. Eines, das groß genug wäre, um uns alle zu
befördern. Aber dann ist mir eingefallen, daß wir ja
nicht unbegrenzt in der Luft bleiben können. Schließ-
lich habe ich an Raketen gedacht.«
Ihre Hände strichen über sein Gesicht. »Du machst
dir zuviel Gedanken.«
»Es
gibt
nur
eines,
was
Erfolg
haben
könnte
–
ein
Bal-
lon. Unser Pech ist nur, daß die Hauptwindrichtung
Südost ist, und das heißt, daß wir früher oder später
nach der See hin abgetrieben würden.« Er seufzte.
Nancy zog ihn hoch. »Komm, laß uns ein wenig am
Strand entlanggehen.«
Als sie schließlich wieder ins Lager zurückkehrten,
waren die Händler gerade mit einer großen Flasche
grünen Weines beschäftigt. Glystra und Nancy tran-
ken jeweils einen kleinen Schluck.
Am nächsten Morgen erwachte Glystra mit einem
üblen Geschmack im Mund. Das Lager war bereits
von hellem Sonnenlicht überflutet. Warum hatte ihn
die letzte Wache nicht geweckt?
Er sah sich um.
Die Händler waren weg ...
Unter der Monobahn lag Pianza, das Gesicht nach
unten.
Die Gondeln waren ebenfalls weg. Vier Fahrzeuge,
beladen mit Metall, Kleidung, Werkzeugen ...
Und Eli Pianza war tot ...
Sie begruben ihn schweigend. »Es hat keinen

Zweck, uns etwas vorzumachen«, sagte Glystra
schließlich. »Dies ist ein schwerer Schlag.«
»Der Wein«, bemerkte Osrik verlegen. »Wir hätten
nicht davon trinken sollen. Sie haben ihn offenbar mit
einem Schlafmittel versehen. Man darf diesen Händ-
lern nie trauen.«
Glystra schüttelte benommen den Kopf und sah zu
Pianzas Grab hinüber. Er war immer ein guter
Freund gewesen.
»Osrik, du brauchst uns nicht weiter zu begleiten.
Die Wagen sind fort und mit ihnen auch unser Me-
tall. Wenn du es bis nach Kirstendale schaffst, kannst
du Faynes Wagen nehmen und damit zur Sumpfstadt
zurückkehren.«
Damit blieben nur noch Asa Elton, Steve Bishop,
Nancy und er selbst übrig. »Noch kann sich jeder von
euch Osrik anschließen. Entbehrungen und vielleicht
sogar der Tod liegen vor uns. Meine besten Wünsche
begleiten jeden, der nach Kirstendale zurückkehren
will.«
Keiner von ihnen wollte. Osrik verabschiedete sich
von ihnen. »Ich wünsche euch allen viel Glück. Hof-
fentlich erreicht ihr euer Ziel.«
Glystra sah ihm nach, wie er sich durch die Bäume
entfernte.
»Also, machen wir eine Bestandsaufnahme. Was ist
uns noch übriggeblieben?«
»Die Gepäckbündel mit den Nahrungskonzentra-
ten, meine Vitaminpillen, Decken, der Wasserzube-
reiter und vier Pistolen«, stellte Bishop fest.
»Da haben wir wenigstens nicht viel zu tragen«,
bemerkte Elton.

Das Ufer zog sich noch vierzig Kilometer dahin. Am
dritten Tag mußten sie einen Fluß überqueren, der in
den See mündete. Sie schlugen zunächst ihr Lager am
Fluß auf und bastelten am nächsten Morgen mit viel
Mühe ein Floß zusammen. Als sie die Böschung am
gegenüberliegenden Ufer erklommen hatten, sahen
sie sich erst einmal um. Im Norden erstreckte sich der
Eyrie, ein Gebirgswall, der von Norden nach Süden
verlief. »Noch drei Tage bis dorthin«, schätzte Bishop.
»Zu Fuß sind wir jetzt vielleicht ebensogut dran
wie mit der Monobahn«, bemerkte Elton. »Stellt euch
die Mühe vor, dort hinaufzukommen.«
Claude Glystra wandte sich um und blickte am
Flußufer entlang in Richtung auf den See. Er sah noch
einmal hin, blinzelte, wandte sich dann an die ande-
ren. »Seht ihr auch, was ich sehe?«
»Ich sehe ein rundes Dutzend Männer auf Zipan-
goten«, bestätigte Elton.
»Die Händler haben eine Gruppe von Rebbirs er-
wähnt. Das könnten sie sein.«
»Wie schön es wäre, auf den Tieren zu reiten«,
seufzte Nancy, »statt durch den Sand zu laufen.«
»Daran habe ich auch schon gedacht«, sagte
Glystra.
»Vor drei Monaten war ich noch ein zivilisiertes,
menschliches Wesen«, sagte Bishopf gedankenvoll.
»Ich hätte nie geglaubt, daß ich einmal als Pferdedieb
enden würde.«
Glystra grinste. »Du würdest dich weniger über
dich wundern, wenn du dir vor Augen hieltest, daß
die Rebbirs noch vor fünf- oder sechshundert Jahren
zivilisierte Erdbewohner waren.«
»Wie machen wir es also?« fragte Elton. »Gehen

wir hin und bringen sie einfach um?«
»Wir sollten es mit möglichst geringem Kraftauf-
wand erledigen«, gab Glystra zurück. »Wir haben nur
noch geringe Reserven in unseren Pistolen.«
»Bei mir reicht es höchstens noch für ein oder zwei
schwache Strahlschüsse«, bestätigte Elton.
»Sie haben uns gesehen«, rief Nancy. »Sie kommen
näher!«
Die Rebbirs jagten in wilder Jagd über die Dünen
hinweg auf sie zu. Es waren größere und schnellere
Tiere als die, die sie in der Sumpfstadt eingetauscht
hatten.
»Sie sehen wie Dämonen aus!« stieß Nancy hervor.
»Den Abhang hinauf!« wies Glystra die anderen
an. »Wir müssen sie möglichst alle zugleich in
Schußweite bekommen.«
Die Rebbirs näherten sich mit wilden, gellenden
Schreien. »Ich zähle insgesamt dreizehn«, sagte
Glystra. »Bishop nimmt die vier zur Linken, Elton die
vier zur Rechten, und ich werde mich um die in der
Mitte kümmern.«
Die Reiter näherten sich in vollem Galopp der An-
höhe, auf der die Männer von der Erde standen. Drei
violette Strahlenbündel – und dreizehn Rebbirs
hauchten ihr Leben aus.
Sie suchten sich die vier kräftigsten Tiere aus und
ließen die anderen frei. Die Schwerter der Rebbirs,
Messer und anderes Metall verstauten sie unter den
Sätteln. Sie legten schwarze Überwürfe und weiße
Turbane an, und dann machte sich die kleine beritte-
ne Gruppe nach den fernen Bergen auf den Weg.
Nancy war von ihrer Verkleidung nicht gerade be-
geistert. »Die Rebbirs stinken wie die Ziegenböcke.

Mein Turban ist ölig und fettig.«
»Das läßt sich nicht ändern«, sagte Glystra.
»Hauptsache, wir kommen auf diese Weise unbehel-
ligt zum Myrtensee ...«
Das Land vor ihnen stieg allmählich an, wurde zu-
sehends steinig und öde.
Nachdem sie vier Tage geritten waren, ragten die
Grate in scheinbar greifbarer Nähe vor ihnen auf. Das
Kabel der Monobahn schwang sich in einem schwin-
delerregenden Bogen in die Höhe. »So kommt man
offenbar vom Myrtensee herunter«, bemerkte Glystra.
»Erinnert ihr euch an die Fahrt ins Galatudanian-
Tal?«
Nancy folgte mit ihren Blicken dem Kabel, das in
schwindelerregender Höhe verschwand. »Das sieht ja
noch schlimmer aus!«
Von einer Plattform der Monobahn aus führte ein
schmaler Pfad im Zickzack in die Höhe. Da sich die
Zipangoten eng an der Felswand entlangschieben
mußten, mußten sich die Reiter im Damensitz auf
dem Rücken der Tiere halten. Die Oberfläche des
Großen Planeten fiel unter ihnen zurück und dehnte
sich zu einem immer weiteren Panorama.
Es ging immer weiter aufwärts. Der Wind trieb
Wolkenfetzen gegen die Felswände; der schmale Pfad
war unvermittelt in milchigweiße Nebel gehüllt.
Dann wieder blies der Wind von unten herauf heftig
gegen die Gratspitzen. Kurz bevor sie den höchsten
Punkt erreicht hatten, hielten sie an. Der Wind wehte
sie fast über die letzte Anhöhe hinweg. Als sie den
Grat überschritten hatten, erstreckte sich vor ihnen
ein Hochplateau mit einer Ausdehnung von guten
zwanzig Meilen. Es war ein steiniges Felsplateau, das

dem Auge keinerlei Abwechslung bot, wenn man
einmal von der in der Ferne verschwindenden Reihe
von Stützpfeilern absah, die das Kabel der Monobahn
trugen.
»Nichts zu sehen«, sagte Glystra. »Also laßt uns –«
»Dort!« Elton wies in Richtung Norden.
Claude Glystra ließ sich in seinen Sattel zurücksin-
ken. »Rebbirs!«
Sie bewegten sich wie eine Ameisenkolonne am
Rande des Plateaus. Glystra schätzte sie auf an die
zweihundert Mann.
»Wir machen uns wohl besser aus dem Staub«,
murmelte er mit belegter Stimme. »Vielleicht lassen
sie uns in Ruhe dahinreiten, wenn wir uns entlang
der Kabelbahn halten.«
Sie machten sich auf den Weg. Glystra ließ die her-
ankommenden Reiter nicht aus dem Auge. »Sieht
nicht so aus, als ob sie uns folgen würden.«
»Doch, jetzt kommen sie«, sagte Elton.
Ein gutes Dutzend Reiter löste sich aus der Kolon-
ne und schlug eine andere Richtung ein. Eine Rich-
tung, die ihren Weg schnitt. Glystra biß die Zähne zu-
sammen. »Die Jagd ist eröffnet!«
Er stieß seine Knie tief in die Seiten seines Reittie-
res. Das Tier gab unwillige Laute von sich, bequemte
sich dann aber zu einem schnelleren Trab. Vierund-
zwanzig Hufe trommelten auf dem felsigen Boden.
Die Rebbirs hatten die Verfolgung aufgenommen.

15
Glystra sah sich nach der Meute der Verfolger um. Sie
hatten sich ihnen noch nicht stärker genähert. Fast
zärtlich streichelte er den Kopf seines Zipangoten.
»Schneller, alter Junge!«
Die Jagd ging Kilometer um Kilometer über das
trostlose Plateau hinweg, nur vom Donnern der Hufe
begleitet. Die Rebbirs begannen sich zu nähern.
Glystra sah sich erneut um, und der Anblick, der sich
ihm bot, hätte einem phantastischen Gemälde ent-
nommen sein können.
Die Rebbirs hatten sich in ihren Steigbügeln erho-
ben und hielten sich dennoch im Gleichgewicht auf
den galoppierenden Tieren. Die wehenden Kaftane
zurückgeworfen, spannten sie Pfeile in ihre großen,
schwarzen Bogen.
»Ducken!« rief Glystra. »Sie schießen mit Pfeilen!«
Gleichzeitig versuchte er sich an der Seite des Tieres
hinabzulassen.
Ein Pfeil pfiff dicht an seinem Kopf vorbei. Vor ih-
nen erhoben sich unvermittelt helle Sanddünen, die
ihren Reittieren das Vorwärtskommen erschwerten.
Lange würden auch diese kräftigen Tiere der Bela-
stung nicht mehr standhalten. Endlich waren sie
durch den Sand hindurch, und vor ihnen erhob sich
eine Felswand, von etlichen schluchtähnlichen Spal-
ten durchzogen. Sie mußten zunächst durch ein lava-
verkrustetes Flußbett hindurch, das vielleicht ein-
oder zweimal im Jahr Wasser führen mochte; dann
ritt Glystra auf eine Schlucht zur Linken zu. »Dort
hinein!« Er atmete stoßweise. »Schnell! Wir müssen

sie uns für kurze Zeit vom Leibe halten, dann haben
wir noch eine Chance!«
Die Schlucht war schmal, eigentlich nur ein Bach-
bett, das aber keinen Tropfen Wasser führte. Hinter
sich vernahmen sie donnernden Hufschlag. Erst laut
und gellend, dann allmählich leiser klang der
Schlachtruf der Rebbirs an ihre Ohren. Unvermittelt
schien der Lärm wieder abzubrechen, Rufe flatterten
hin und her. Die Rebbirs waren offenbar in eine brei-
tere Schlucht dicht neben der ihren geraten und be-
merkten jetzt ihren Irrtum.
Die enge Schlucht wandte sich vor ihnen in steilen
Windungen zu einem Grat empor. Glystra verstän-
digte sich mit den anderen durch Zeichen. »Dort hin-
auf.« Sie hatten erhebliche Mühe damit, ihre Tiere zu
der Klettertour zu bewegen. »Schnell, sie können je-
den Augenblick da sein.«
Das Schreien kam wieder näher.
Glystra trieb sein Tier als letztes das Bachbett hin-
auf. Die Rebbirs setzten ihm nach, Schwerter in der
Hand. Die enge Schlucht hinter ihm war schon bald
von einer brodelnden Masse schwarzer Kaftane und
Tierleibern erfüllt. Nancy überwand gerade den
höchsten Punkt, Bishop und Elton folgten ihr dicht-
auf.
Elton wußte, was zu tun war. Sein breites Lachen
ließ seine Zähne aufblitzen, der Ionenstrahler lag
schußbereit in seiner Hand. Er zielte auf das erste
Reittier der Rebbirs und betätigte den Abzug. Der Zi-
pangote warf die Vorderläufe in die Höhe und fiel
gegen die nachfolgenden Reiter. Glystra riß sein eige-
nes Tier bis zur letzten Anhöhe hinauf. Hastig liefen
sie den Grat entlang, bis sie endlich in einem engen

Tal auf der rückwärtigen Seite der Felswand Zuflucht
fanden. Sie waren mit ihren Kräften am Ende. »Sie
werden uns hier nicht so schnell finden. Wenn sie
sich überhaupt die Mühe machen, noch nach uns zu
suchen. Auf jeden Fall dürften wir sicher sein, bis die
Dunkelheit hereinbricht.« Er sah zu dem sich lang-
sam beruhigenden Zipangoten hinüber, der ihn bis
nach hier gebracht hatte. »Du bist ein braves Tier,
wenn auch nicht gerade eine Schönheit.«
Nach Einbruch der Dunkelheit kehrten sie so laut-
los wie möglich wieder auf den Grat zurück und
folgten ihm in östlicher Richtung. Weit hinter sich
vernahmen sie heiseres Geschrei. Glystra hielt sein
Reittier an und lauschte. Inzwischen war tiefe Stille
eingekehrt.
Der Zipangote scharrte unruhig mit den Hufen,
schnaubte leise. Wieder tönte das heisere Schreien
aus der Dunkelheit zu ihnen herüber. Glystra führte
das Tier weiter. »Wir müssen versuchen, während
der Nacht einen möglichst großen Abstand zu diesen
Dämonen zu gewinnen, oder wenigstens irgendein
Versteck zu suchen.«
Langsam zog die kleine Karawane dahin. Aus der
Ferne klang ihnen nochmals das heisere Geschrei der
enttäuschten Rebbirs hinterher. Glystra warf noch ei-
nen Blick zurück. Leuchtende Meteoritenbahnen zo-
gen sich über den nächtlichen Himmel.
Als der Morgen heraufdämmerte, konnten sich
selbst die Zipangoten kaum noch auf den Beinen
halten. Die Köpfe an den überlangen Hälsen hingen
manchmal fast bis auf den Boden herab. Im Schein
der aufgehenden Sonne konnten sie in östlicher
Richtung die Umrisse von Gebüsch und Bäumen

ausmachen. Vor ihnen erstreckte sich eine Insel der
Vegetation, die nahezu zehn Meilen lang sein mochte,
und um die sich ein heller, glitzernder See herumzog.
In ihrer Mitte erhob sich eine metallen glänzende
Kuppel, wie eine auf den Boden aufgesetzte Halbku-
gel.
»Das scheint der Myrtensee zu sein«, sagte Glystra.
»Der Brunnen am Myrtensee.«
Als sie den Schatten der Bäume erreichten, war es
wie der Einzug in das Paradies. Glystra glitt von sei-
nem Tier, band es an einer Wurzel fest, und half Nan-
cy beim Absteigen. Ihr Gesicht war blaß und
schmerzverzogen, aber auch Bishop und Elton war
die Erschöpfung anzumerken.
Die Zipangoten schnüffelten im grünen Moos, leg-
ten sich nieder und wälzten sich auf dem Boden.
Glystra beeilte sich, ihnen das Gepäck abzunehmen,
bevor es Schaden nehmen konnte.
Nancy lag ausgestreckt im Schatten. Bishop hatte es
sich neben ihr bequem gemacht.
»Hunger?« fragte Glystra.
Nancy verneinte mit einem Kopfschütteln. »Nur
schrecklich müde. Es ist so friedlich hier. Ich glaube,
da singt sogar ein Vogel.«
Glystra lauschte. »Hört sich tatsächlich so an.«
Asa Elton öffnete sein Gepäck, vermengte sein Vit-
aminkonzentrat mit pulverisierten Nahrungsmitteln,
feuchtete das Ganze an und verrührte es zu einem
zähflüssigen Brei. Diesen gab er in Faynes Kocher,
verschloß den Deckel, um ein paar Augenblicke spä-
ter ein heißes Gebäck zu entnehmen.
Glystra ließ sich ebenfalls in das weiche Moos fal-
len. »Wir müssen Kriegsrat halten.«

»Du willst Probleme wälzen?« fragte Elton.
Glystra sah in das grüne Laub hinauf. »Ohne Nan-
cy waren wir acht, als wir von Jubilith aus loszogen.
Du, Bishop und ich. Außerdem Pianza, Ketch, Darrot,
Fayne und Vallusser. Wir haben tausend Meilen hin-
ter uns gebracht, und mittlerweile sind nur noch vier
von uns übrig.«
»Willst du uns bange machen?«
Glystra zog es vor, diesen Einwand zu überhören.
»Als wir von Jubilith aufbrachen, hielt ich die Aus-
sichten noch für gut. Ich hoffte, wir würden die Er-
denklave erreichen, erschöpft und mit zerschundenen
Füßen zwar, aber lebendig. Ich war zu optimistisch.
Jetzt müssen wir uns alles noch einmal überlegen.
Wer von euch mit der Monobahn nach Kirstendale
zurückkehren will, den werden meine besten Wün-
sche begleiten. Die Schwerter der Rebbirs enthalten
genug Metall, um uns alle zu reichen Leuten zu ma-
chen. Wer also lieber ein lebender Kirstendaler denn
ein toter Erdenbürger sein will, der sollte sich jetzt
endgültig entschließen. Niemand wird ihm Vorwürfe
bereiten.«
Keiner gab eine Antwort.
Glystra sah noch immer zu den Blättern hinauf.
»Wir werden uns hier am Myrtensee ein oder zwei
Tage ausruhen.«
Er bewegte sich leise über das Moos und sah auf sei-
ne Begleiter hinab. Elton schlief wie ein unschuldiges
Kind. Bishop schnarchte lautstark. Nancys Hände
bewegten sich unruhig im Schlaf. Ihm fiel ein, daß die
Händler Pianza getötet hatten, während dieser Wache
stand. Warum hatten sie sich damit zufrieden gege-

ben? Von ihrem Standpunkt aus wäre es doch konse-
quent gewesen, sie alle zu töten. Daß sie Skrupel
nicht kannten, hatten sie ohnehin schon bewiesen.
Zudem waren die Männer von der Erde mit wertvol-
len Kleidungsstücken angetan gewesen und hatten
zahlreiche Metallgegenstände mit sich geführt. Allein
die Ionenstrahler stellten für ihre Begriffe einen un-
schätzbaren Wert dar. Warum also waren sie nicht
alle im Schlaf ermordet worden? Waren die Händler
vielleicht von jemandem daran gehindert worden,
dessen Autorität – vielleicht durch einen Ionenstrah-
ler begründet – sie davon überzeugt hatte, daß seinen
Anweisungen zu gehorchen war?
Er wandte sich ab. Schmerz und eine nagende Un-
gewißheit erfüllten ihn. Ein seitliches Geräusch er-
schreckte ihn. Es war Nancy. Er atmete erleichtert
auf. »Du hast mich tatsächlich erschreckt.«
»Claude«, flüsterte sie. »Laß uns zurückgehen.« Sie
war sichtlich außer Atem. »Ich weiß, mir steht es
nicht zu, so etwas zu sagen, da ich nur ein ungelade-
ner Gast bin. Aber du wirst mit Sicherheit den Tod
finden, wenn du weitergehst. Ich will nicht, daß du
stirbst. Warum sollen wir nicht leben, du und ich?
Wenn wir nach Kirstendale zurückkehren, können
wir uns ein gemeinsames Leben einrichten.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht. Es hat kei-
nen Zweck, wenn du mich zu überzeugen versuchst.
Aber ich glaube, du solltest umkehren.«
Sie trat zurück und sah ihn mit großen Augen an.
»Du magst mich nicht mehr?«
Er antwortete mit einem müden Lächeln. »Aber ja
doch. Ich brauche dich. Aber ich weiß auch, daß es
einem Wunder gleichkommt, daß wir überhaupt so

weit gekommen sind. Unser Glück kann nicht ewig
andauern.«
»Und darum will ich, daß du zurückgehst!« Sie
legte ihm die Hände auf die Schultern. »Claude, war-
um willst du nicht aufgeben? Ist es nicht wirklich
hoffnungslos?«
»Nein.«
Tränen liefen über ihre Wangen. Er suchte nach
Worten des Trostes, aber sie blieben ihm in der Kehle
stecken. »Du solltest dich ausruhen, Nancy«, brachte
er schließlich heraus.
Sie wandte sich um und ging bis zum äußersten
Rand der grünen Oase. Reglos stand sie da und
blickte über die Wüste hinweg.
Glystra setzte seine Wanderung über das weiche,
grüne Moos fort.
Als er eine Stunde später wieder zurückkam, lag
Nancy schlafend im Moos, den Kopf auf die Arme
gelegt. Irgend etwas an ihrer steifen Haltung, viel-
leicht in der Art, wie sie den anderen den Rücken
zuwandte, ließ ihn erkennen, daß seine Beziehung zu
ihr nie wieder so sein würde wie zuvor.
Er ging zu dem Ort, an dem Asa Elton schlief und
tippte leicht gegen seine Schulter. Elton öffnete die
Augen.
»Deine Wache. Wecke Steve in einer Stunde.«
Elton gähnte und raffte sich auf. »Ist in Ordnung.«
Ein Geräusch – vage, hämmernd. Es versuchte in
die Welt hinter seinen Augenlidern einzudringen und
stritt mit aller Macht gegen Glystras Müdigkeit. Es
war ein ferner Laut. Gefahr!
Glystra sprang hellwach auf, riß den Ionenstrahler
aus der Tasche.

Elton lag noch immer schlafend neben ihm.
Von Steve Bishop und von Nancy war nichts zu se-
hen.
Harte Stimmen klangen auf. Ein Schlag. Noch ein
Schlag. Dann war wieder Stille.
Glystra lief durch das Gebüsch und stürzte fast
über eine am Boden liegende Gestalt. Entsetzen
lähmte seine Glieder.
Steve Bishop.
Jemand ergriff seinen Arm. »Claude!« Es war Elton,
der inzwischen ebenfalls zu sich gekommen war.
»Steve ist tot. Sie haben ihn umgebracht.«
»Aber wo ist Nancy?«
»Ja. Wo ist sie?«
Er blickte sich um und sah dann wieder auf den
toten Körper zu seinen Füßen. »Die Mörder Steves
haben sie entführt«, sagte Elton. »Sieh dir die Fuß-
spuren hier im Moos an.«
Glystra sah den Spuren nach. Seine Wut und seine
Verzweiflung erreichten einen Höhepunkt. Er lief in
Richtung auf die domartige Kuppel los. Durch Zy-
pressensträucher hindurch, mit goldenen Früchten
beladen, geriet er auf einen gepflasterten Weg, der
unmittelbar auf das große Gebäude zuführte. Von
Nancy und ihren Entführern war nichts zu sehen.
Unschlüssig verhielt er einen Augenblick lang, dann
lief er weiter, durch einen gepflegten Garten mit
Springbrunnen und Spazierwegen hindurch. Er ent-
deckte einen alten Mann in grauer Mönchskleidung,
der mit den Blumen beschäftigt war.
»Wohin sind sie verschwunden? Die Männer, die
das Mädchen mit sich führten?«
Der
Alte
sah
ihn
mit verständnislosem Ausdruck an.

»Antworte mir, sonst –«
Elton holte ihn ein. »Laß ihn, Claude. Er ist taub.«
Claude Glystra starrte den Mönch an, wandte sich
ab. Ihm fiel jetzt auf, daß am Ende des Weges eine
Tür durch eine Mauer führte. Sicher hatten sie diesen
Weg genommen. Er rannte los und versuchte vergeb-
lich, die Tür zu öffnen. Sie widerstand seinen Bemü-
hungen, als wäre sie ein Teil der Mauer selbst.
Schreiend trommelte er auf der Tür herum. »Öffnet
die Tür! Aufmachen! Macht die Tür auf, sage ich!«
»Das bringt dir höchstens einen Messerstich ein«,
meinte Elton.
Glystra setzte ein paar Schritte zurück und starrte
das Steingebäude an. »Noch habe ich den Ionen-
strahler. Es wird viel Blut fließen, bis Bishop gerächt
ist.«
»Ich glaube, du solltest mit etwas mehr Überlegung
an die Sache herangehen. Erst einmal sollten wir nach
den Tieren sehen, bevor die auch noch weg sind.« Er-
hebliche Ungeduld klang in Eltons Stimme mit.
Glystra sah noch einmal zu der Mauer hoch. »Du
hast recht. Armer Bishop.«
»Wir werden ihn vielleicht nicht länger denn einen
Tag überleben«, erklärte Elton ruhig.
Die Zipangoten grasten noch an der gleichen Stelle,
an der sie sie zurückgelassen hatten. Schweigend
machten sie sich daran, sie mit ihrem Gepäck zu be-
laden. Elton unterbrach seine Tätigkeit plötzlich.
»Willst du wissen, was ich machen würde, wenn ich
das Sagen hätte?«
»Was?«
»Ich würde sagen, wir reiten von hier aus in Rich-
tung Osten, so weit wir es schaffen!«

Glystra schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht,
Asa.«
»Hier stimmt etwas nicht. Ich spüre es.«
»Das ist mir auch klar. Aber ich muß in Erfahrung
bringen, was es ist. Ich kämpfe einen Kampf, der
schon verloren ist. Du kannst immer noch nach Kir-
stendale zurück.«
Elton gab einen unwilligen Laut von sich.
Sie bestiegen die Tiere und ritten auf die Kuppel
zu.

16
Sommerliche Geräusche erfüllten die Luft: Vögel
zwitscherten, zahllose kleine Insekten summten, und
Blätter rauschten im sanften Wind. Sie kamen an ei-
ner Wiese vorbei, auf der ein kleines Kind spielte. Bei
ihrem Anblick vergaß es seine Spielsachen und
starrte sie mit weitgeöffnetem Mund an.
Sie erreichten eine breite Allee, an deren rechter
Seite sich künstlich angelegte Bäche dahinzogen,
während sich auf der linken Seite ein kleiner Laden
an den anderen reihte. Es war ein Basar, wie Glystra
bereits viele auf seinen Reisen gesehen hatte. Es wur-
den Teppiche angeboten, Schals, Früchte, allerlei Ge-
brauchsgegenstände, wie man es eben bei einem sol-
chen Markt gewohnt war. Der Unterschied war nur
der, daß über all diesen Dingen eine dicke Staub-
schicht lag. Niemand stellte sich ihnen in den Weg,
als sie auf ihren Zipangoten vorüberritten.
Ein Laden, der etwas größer war als die anderen,
führte als Handelszeichen ein hölzernes Schwert.
Glystra brachte sein Tier zum Stehen. »Mir ist so eine
Idee gekommen. Ich werde es mal versuchen.« Er
nahm zwei von den Schwertern, die sie den Rebbirs
abgenommen hatten, und trat in die Dunkelheit des
Ladens hinein.
Ein kleiner, dicklicher Mann, der sich über einen
der Ladentische gebeugt hatte, sah zu ihm auf.
Glystra warf die Schwerter auf den Tisch. »Was wä-
ren sie dir wert?«
Der Ladeninhaber sah sie an, und sein Gesichts-
ausdruck veränderte sich augenblicklich. Er machte

gar nicht erst den Versuch, sein Interesse zu verber-
gen. »Woher haben Sie diese Schwerter?«
Seine Finger glitten über das Metall. »Sie sind aus
dem feinsten Stahl gefertigt. Nur die Anführer der
südlichen Rebbirs besitzen solche Schwerter.«
»Ich könnte sie dir billig geben.«
Die Augen des Händlers leuchteten auf. »Was
wollen Sie dafür haben? Einen Sack voll Peraldinen?
Einen Helm aus Perlmutt, mit einem Opal von der
Magischen Quelle gekrönt?«
»Viel weniger als das«, erklärte Glystra. »Vor einer
Stunde etwa wurde eine Frau in diesen Dom entführt.
Ich möchte sie zurückhaben.«
»Sie erlauben sich wohl einen Scherz mit mir? Zwei
Stahlschwerter für eine Frau? Für diese beiden
Schwerter werde ich Ihnen vierzehn Jungfrauen be-
sorgen, alle so schön wie die Morgensonne.«
»Nein«, sagte Glystra. »Ich will nur diese eine Frau
haben.«
Der Händler legte wie abwesend die Hand an sei-
nen Hals. »Um ehrlich zu sein, ich will die Schwerter
haben. Aber ich habe nur einen Kopf.« Er wog eines
der beiden Schwerter in der Hand. »Die Dongmänner
sind unberechenbar; manchmal könnte man sie für
verrückte alte Greise halten, dann wieder hört man
von Taten und Grausamkeiten, die man sich kaum
vorstellen kann. Es ist schwer zu entscheiden, was
man glauben soll.«
»Nun?«
»Was also wollen Sie?«
»Wie ich bereits sagte, ich will diese Frau zurück
haben. Sie ist jung und hübsch. Vermutlich wurde sie
in irgendeinen Harem gebracht.«

Der Händler schüttelte den Kopf, schien über
Glystras Vermutung eher erstaunt zu sein. »Das
glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist sie zu den Skla-
vinnen gebracht worden.«
»Ich weiß nicht, was in diesem Dom – oder ist es
ein Tempel? – los ist. Deshalb brauche ich die Hilfe
von jemandem, der damit vertraut ist.«
»Ich verstehe. Sie sind also bereit, Ihren eigenen
Kopf aufs Spiel zu setzen?«
Glystra sah den Händler wütend an. »Ja. Aber
glaube nur nicht, daß du das nicht ebenfalls mußt.«
»Nein«, entgegnete der Händler kühl. »Aber es gibt
jemand anderen, der es für mich tun wird.« Er
stampfte kräftig mit dem Fuß auf den Boden. Einen
Augenblick später trat ein junger Mann ein. Er gab
einen Laut der Überraschung von sich, als er die
Schwerter erblickte.
»Das ist mein Sohn Nymaster«, stellte der Händler
vor. Er wandte sich an den jungen Mann. »Eines die-
ser Schwerter ist für dich. Zuerst führst du diesen
Herrn durch Zellos Eingang in den Tempel. Ihr ver-
kleidet euch und nehmt weitere Kleider mit. Dieser
Herr wird dir die Frau zeigen, die er zurückhaben
will. Sie befindet sich sehr wahrscheinlich unter den
Sklavinnen. Du wirst Koromutin bestechen müssen;
versprich ihm einen Porphyr-Dolch. Und dann bringe
die Frau zurück.«
»Das ist alles? Dann gehört mir das Schwert?«
»So ist es.«
Nymaster wandte sich Glystra zu. »Kommen Sie.«
»Augenblick.« Er ging zur Tür und rief Elton her-
bei. Elton betrat den Laden und sah sich darin um,
ohne auch nur eine Miene zu verziehen.

Glystra deutete auf die beiden Schwerter auf der
Tischplatte. »Er bekommt diese beiden Schwerter,
wenn ich mit Nancy zusammen zurückkehre. Sollten
wir nicht wiederkommen, dann töte ihn.«
Der Händler wollte protestieren. Glystra sah ihn
an. »Glaubst du vielleicht, daß ich Vertrauen zu dir
habe?«
»Vertrauen?« Der Händler starrte ihn verwundert
an. »Was ist das – Vertrauen?«
Glystra grinste Elton an. »Sollten wir uns nicht
wiedersehen – viel Glück. Nütze unsere Reichtümer,
vielleicht kannst du es hier irgendwo zum Herrscher
bringen.«
Nymaster verbeugte sich vor Glystra, und sie ver-
ließen den Laden. Sie gingen um das Gebäude herum
und betraten einen schmalen Gang, der zwischen
zwei Zäunen hindurchführte. Sie erreichten eine klei-
ne Hütte, deren Tür unverschlossen war. Nymaster
ging hinein und kehrte wenig später mit einem Bün-
del Kleider zurück, das er Glystra reichte. »Ziehen Sie
das an.«
Es war ein wallendes Gewand mit einer spitzen
Haube, alles ganz in Weiß. Er zog es über den Kopf.
»Und jetzt noch das hier«, sagte Nymaster und
reichte ihm einen ärmellosen Überwurf, der ein we-
nig kürzer war als das weiße Gewand. »Und das.« Er
gab ihm dazu noch eine lose, schwarze Jacke, die
noch kürzer war, dazu eine zweite Kopfbedeckung.
Nymaster kleidete sich in der gleichen Weise ein.
»Es ist die Kleidung der Dongmänner. Kein Mensch
wird nach unserem Woher und Wohin fragen, wenn
wir erst einmal innerhalb der Tempelhallen sind.« Er
trug noch ein weiteres Paket mit Kleidern unter dem

Arm, und er sah ungeduldig auf den Gang hinaus.
»Schnell jetzt, hier entlang.«
Sie gingen etwa hundert Meter bis zu einer Pforte
im Zaun und kamen in einen mit Farnen überwu-
cherten kleinen Garten. Nymaster hob hin und wie-
der seine Hand, um Glystra zu äußerster Vorsicht zu
mahnen. Durch das Blättergerank erspähte Glystra
einen äußerst hageren alten Mann, der im Schein der
Sonne umherspazierte. Ein wenig weiter spielten
sechs Kinder.
»Wenn wir die Mauer erreichen wollen«, wisperte
Nymaster, »dann müssen wir unbemerkt an Zello
vorbeikommen. Wenn er uns nämlich sieht, wird er
mit seinem Geschrei die anderen warnen.«
Er nahm einen kleinen Erdklumpen auf und warf
ihn nach einem der Kinder, einem kleinen Jungen.
Der schrie auf, um sich aber rasch wieder zu beruhi-
gen und erneut dem Spiel mit seinen Gefährten zu-
zuwenden. Zellos Aufmerksamkeit aber wurde da-
durch einen Augenblick lang abgelenkt, und diesen
Augenblick benutzten Nymaster und Glystra, um
hinter einer halbverfallenen Mauer Deckung zu su-
chen, nachdem sie über die offene Rasenfläche gelau-
fen waren.
Aus ihrer Deckung heraus sahen sie zum Turm des
Tempelgebäudes hinauf. »Dort oben ist manchmal
eine Wache postiert, die nach ankommenden Gästen
Ausschau hält. Werden wichtige Gäste erwartet, ge-
winnen sie auf diese Weise Zeit, um das Orakel vor-
zubereiten.«
»Ja, da ist einer – er sucht die Wüste ab.« Die
dunkle Gestalt stand bewegungslos hinter den Turm-
zinnen.

»Er wird uns nicht entdecken«, erklärte Nymaster.
»Er sieht in eine ganz andere Richtung.« Er kletterte
die Mauer hinauf, wobei ihm Spalten und Risse als
Halt für Hände und Füße dienten. Glystra folgte ihm.
In halber Höhe verschwand Nymaster vor Glystras
Augen in einer Spalte im Mauerwerk, die von unten
her nicht zu sehen gewesen war. »Die Mauer ist
hohl«, kam Nymasters Stimme aus dem Inneren her-
aus. »Sie wurde nur zum Schein so massiv gebaut.
Hier drinnen ist ein Gang, in dem man sich frei be-
wegen kann.«
Mit Hilfe eines Feuersteins entzündete Nymaster
eine Lunte, die nach kräftigem Blasen aufflammte
und ihre neue Umgebung erhellte. Mit sicheren
Schritten ging der junge Mann voran. Nach fast
zweihundert Metern erreichten sie eine Öffnung im
Boden, die gerade groß genug war, um eine einzelne
Person hindurchzulassen. »Achtung! Die Stufen sind
nur in Ton geschlagen.«
Sie stiegen knappe drei Meter hinab, mußten sich
ducken, um unter einem Ausläufer des Fundaments
hindurchzukommen, und bewegten sich durch einen
leicht aufwärtsführenden Gang weiter. Sie befanden
sich nach Nymasters Angaben jetzt unter dem großen
Empfangsraum. »Dort drüben ist der Sitz der Wahr-
heit, auf dem das Orakel sitzt.«
Hastige, ein wenig schlurfende Fußtritte kamen
von oben. »Das ist der alte Caper, der Hausmeister.
Er hat ein verkrüppeltes Bein.«
Wieder wurden sie von einem Teil des Fundaments
behindert.
»Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Wenden Sie
Ihr Gesicht vom Lichtschein ab und sagen Sie kein

Wort. Wenn man uns anhält und wir erkannt werden
–«
»Was geschieht dann?«
»Kommt auf den Rang dessen an, der uns entdeckt.
Am schlimmsten sind die Novizen, die mit schwar-
zen Roben angetan sind. Sie sind noch neu in ihrem
Amt und nehmen es übermäßig genau. Ebenso die
Hierarchen, die an ihren goldenen Quasten zu erken-
nen sind. Die Ordinarien nehmen es meist weniger
genau.«
»Wie geht es nun weiter?«
»Dieser Gang führt zu den Räumen, in denen die
Sklaven und Gefangenen vor ihrer Verwendung un-
tergebracht werden.«
»Verwendung? Sollen sie etwa als Orakel dienen?«
Nymaster schüttelte den Kopf. »Nein. Sie haben ei-
ne andere Bestimmung. Das Orakel braucht das Wis-
sen von vier Personen, die seine Gedanken lenken
müssen. Wenn das Orakel befragt wird, wirken also
noch drei weitere Personen mit.«
Glystra ergriff ungeduldig Nymasters Arm. »Vor-
wärts!«
»Wir müssen jetzt äußerst leise sein«, warnte Ny-
master. Er ging um einen Felsblock herum, stieg eine
einfache Holzleiter hinauf und kroch oben auf einem
schmalen Vorsprung weiter. Glystra folgte.
Nymaster lauschte und erhob sich dann. »Mir nach.
Schnell jetzt!«
Er verschwand. Glystra ließ sich hinter ihm in ei-
nen dunklen Schacht hinab. Er stand hinter Nyma-
ster, berührte fast seinen Rücken. Vor ihren Füßen
floß übelriechendes Wasser dahin. Vor ihnen war dif-
fuses Licht zu erkennen. Eine Anzahl von Stufen

führte aufwärts. Sie gingen die Stufen hinauf und
standen unvermittelt in einem erhellten Raum.
Es war heiß, und die Luft war mit einem tranigen
Ölgeruch geschwängert. Geräusche verrieten ihnen,
daß irgendwo vor ihnen ein geschäftiges Treiben
herrschen mußte.
Es fiel Glystra nicht leicht, Übelkeit und Brechreiz
zu unterdrücken. Nymaster ging vor ihm mit raschen
Schritten den Gang entlang.
Mehrere Männer in Roben kamen an ihnen vorbei,
ohne sie weiter zu beachten. Nymaster verhielt seine
Schritte.
»Hinter dieser Wand befinden sich die Räume der
Gefangenen. Sehen Sie durch eine der Ritzen hin-
durch und sagen sie mir, welche der Frauen sie su-
chen.«
Glystra trat dicht an die Steinwand heran und
spähte durch einen schmalen Spalt in Augenhöhe.
Ein gutes Dutzend Männer und Frauen saßen entlang
der Wände oder standen inmitten des Raumes. Ihre
Haare waren abrasiert und ihre Köpfe mit gelber,
blauer oder grüner Farbe bemalt worden.
»Welche ist es? Die am äußersten Ende?«
»Ich kann sie nicht sehen. Sie ist nicht dabei.«
»Dann wird es schwierig«, murmelte Nymaster.
»Ich fürchte, das geht über unsere Abmachungen
hinaus.«
»Unsinn. Unsere Abmachung lief darauf hinaus,
die Frau zu finden und zu befreien, wo immer sie sich
befinden mochte. Bring mich zu ihr, oder ich werde
dich augenblicklich umbringen!«
»Ich weiß nicht, wo ich sie suchen soll«, erklärte
Nymaster ruhig.

»Finde es heraus. Das ist deine Sache.«
Nymaster legte die Stirn in Falten. »Ich werde Ko-
romutin fragen. Warten Sie hier.«
»Nein, ich komme mit.«
Nymaster schimpfte unwillig vor sich hin, als sie
den Gang hinabgingen. Er steckte seinen Kopf in eine
kleine Kammer hinein. Darin befand sich ein dickli-
cher Mann in den mittleren Jahren. Er war kaum
überrascht, Nymaster zu sehen.
Glystra beugte sich vor, um die leise geführte Un-
terhaltung verfolgen zu können. Koromutin musterte
ihn eingehend.
»Er sagt, daß sie nicht bei den anderen Gefangenen
ist, und er will nicht wieder gehen, bevor er sie ge-
funden hat.«
Koromutin dachte nach. »Dann muß sie sich in den
oberen Gemächern befinden. Wenn es so ist – nun,
was bietet der Herr Vater dafür an? Mir fällt gerade
ein, er hatte einen Dolch aus bestem Philemon-
Porphyr ...«
»Er soll dir gehören.«
Koromutin erhob sich händereibend und musterte
Glystra noch einmal eingehend. »Die Dame ist gewiß
eine hochwohlgeborene Prinzessin, mein Herr.« Er
verbeugte sich vor Glystra. »Gestatten Sie mir, Ihnen
behilflich zu sein.« Damit wandte er sich um und
ging den anderen voraus.
Sie folgten einer sich windenden Treppe nach oben.
Schritte kamen ihnen entgegen. Koromutin verbeugte
sich tief. »Tief verbeugen!« wisperte Nymaster. »Der
Superior kommt.«
Glystra machte einen Bückling, wie es tiefer nicht
ging. Er sah gerade noch den Saum einer reich ver-

zierten Robe. Er hörte, wie eine hohe Fistelstimme
fragte: »Wo steckst du nur, Koromutin? In aller Kürze
findet eine Orakel-Sitzung statt. Du scheinst dich ver-
spätet zu haben. Wir brauchen die Weisheit.«
Koromutin brachte eine Flut von Entschuldigungen
hervor. Der Superior ging wieder nach oben, wäh-
rend Koromutin in seine Kammer zurückging und
ein buntes Ornat überwarf.
»Warum das alles?« fragte Glystra.
Nymaster zuckte mit den Schultern. »Es ist die
Aufgabe des alten Koromutin, die Zeremonie mit
dem Orakel durchzuführen. Wir müssen warten, bis
es vorbei ist.«
»Wir haben aber keine Zeit.«
»Koromutin muß an der Sitzung teilnehmen. Uns
bleibt keine andere Wahl. Abgesehen davon möchte
ich die Zeremonie gern einmal miterleben. Ich war
noch nie dabei, obwohl mir schon oft davon berichtet
worden ist.«

17
Koromutin beschäftigte sich weiter mit seinen Vorbe-
reitungen. Aus einem verschlossenen Schrank holte
er einen Glasbehälter mit einer gelblich-trüben Flüs-
sigkeit hervor, die er in eine Spritze füllte.
»Was ist das?«
»Die Weisheit«, erklärte Koromutin selbstgefällig.
»Es ist ein sehr hochwertiges Konzentrat. Der Ver-
stand von vier Männern geht in eine jede dieser Fül-
lungen.«
Hormone, überlegte Glystra.
Koromutin befestigte die Spritze an seiner Kopfbe-
deckung.
»Gehen wir.«
Er führte sie einen langen Gang hinunter und über
eine Anzahl von Treppen in den großen Empfangs-
raum unter der hohen Domkuppel. Zwölf Novizen
hatten sich bereits in einem Halbkreis aufgestellt. »Zu
wenig«, murmelte Koromutin. »Lord Voivode wird
wenig begeistert sein. Ihm ist eine großartige Zere-
monie weit wichtiger als die Weisheit des Orakels
selbst. Ich muß nun meinen Platz einnehmen. Ihr geht
am besten dort hinüber, auf die andere Seite. So fallt
ihr am wenigsten auf.«
Nymaster und Glystra taten, wie ihnen geheißen
wurde. Wenig später wurde eine Sänfte in die Halle
getragen, von vier in Schwarz gekleideten Dienern
begleitet. Dahinter folgten noch zwei junge Mädchen,
die einen gepolsterten Stuhl zwischen sich trugen.
Als die Träger die Sänfte herabließen, kam ein klei-
ner, rotgesichtiger Mann daraus hervor, der sich so-

gleich in dem bereitgestellten Stuhl niederließ.
»Schnell,
schnell!«
rief
er.
Zugleich
winkte
e r
aufge-
regt. »Mein Leben geht zu Ende, und das Licht ver-
läßt meine Augen, während ich hier sitze und warte.«
Der Superior trat auf ihn zu und verbeugte sich.
»Vielleicht möchte sich der Lord während der einfüh-
renden Riten ein wenig erfrischen?«
»Zum Teufel mit den Riten!« schnaubte Lord Voi-
vode.
Der Superior trat zurück und verkündete: »Das
Orakel kommt.«
Zwei Novizen führten eine schwarzhaarige Gestalt
in einem weißen Überwurf heran. Es war ein ziemlich
ausgemergelter Mann, der sich wie ein gefangenes
Tier umsah.
Der Voivode gab lautstark seine Enttäuschung
kund. »Eine solche Kreatur soll mich beraten? Sie
scheint zu nichts anderem fähig zu sein, als vor Angst
zu zittern.«
»Vergessen Sie bitte Ihre Vorurteile, Lord«, bat der
Superior. »Durch ihn werden Sie des Wissens von
vier Männern teilhaftig werden.«
Die bedauernswerte Gestalt wurde auf einen Sitz
gehoben – den Sitz der Wahrheit. Bald darauf er-
schien Koromutin in seiner steifen Robe. Er stieg zu
dem Sitz hinauf, nahm die Spritze von seiner Kopf-
bedeckung ab und stieß die Nadel ins Genick des
Orakels. Der Mann krümmte sich, warf die Arme
hoch. Einen Augenblick lang saß er reglos da, um
dann in sich zusammenzusinken. Er nahm den Kopf
in die Hände und rieb sich über die Stirn. Seine Glie-
der zuckten, und verworrene Laute kamen aus sei-
nem Mund.

Glystra sah atemlos zu.
Die Muskeln des Orakels waren angespannt, und
in seinen Augen stand ein seltsames Leuchten. Er-
schöpft fiel es schließlich in seine schlaffe Haltung
zurück.
Lord Voivode nickte beifällig und unterhielt sich
leise mit dem Superior, der alsbald mit lauter Stimme
verkündete: »Es ist so weit. Fünf Minuten lang stehen
Ihnen die Weisheiten des Orakels zur Verfügung.«
Lord Voivode beugte sich nach vorn. »Orakel, ich
frage dich: Wie lange habe ich noch zu leben?«
Das Gesicht des Orakels überzog ein müdes Lä-
cheln. »Sie fragen zwar nach Nebensächlichkeiten,
aber ich werde Ihnen antworten. Warum sollte ich
nicht? Aus Ihrer Körperhaltung, Ihrer Gangart und
verschiedenen weiteren Tatsachen ist zu entnehmen,
daß Sie innerlich vom Krebs verzehrt werden. Ihr
Atem ist bereits der der Verwesung. Ich gebe Ihnen
im höchsten Falle noch ein Jahr Lebenszeit.«
Voivode wandte sich mit verzerrtem Gesicht an
den Superior. »Das Orakel lügt! Hinweg mit ihm! Ich
bezahle mit guten Sklaven, und dann bekomme ich
Lügen vorgesetzt!«
Der Superior begütigte ihn mit einer Handbewe-
gung. »Kommen Sie niemals zum Brunnen am Myr-
tensee, wenn Sie nur Ihre eigenen Wünsche und
Hoffnungen bestätigt finden wollen; hier bekommen
Sie nur die Wahrheit zu hören, Lord Voivode.«
Voivode wandte sich erneut an das Orakel. »Wie
kann ich mein Leben verlängern?«
»Darüber habe ich kein genaues Wissen. Eine ge-
eignete Kur, gewisse Diäten, Enthaltsamkeit von
Narkotika und karitative Taten könnten zu einer

Verlängerung beitragen.«
Lord Voivode beschwerte sich ärgerlich beim Supe-
rior. »Warum haltet ihr mich zum Narren; dieses Ge-
schöpf gibt nur blanken Unsinn von sich. Warum ver-
rät es mir nicht die Formel?«
»Was für eine Formel?« erkundigte sich der Supe-
rior.
»Die Formel zur Herstellung eines Trankes, der
ewiges Leben schenkt. Diese Formel will ich wissen,
und nichts anderes!«
»Fragen Sie selbst«, riet der Superior.
Voivode brachte seine Frage vor.
»Bei all meiner Erfahrung kann ich Ihnen nicht mit
Informationen dienen, die Ihnen zum Besitz einer sol-
chen Formel verhelfen würden«, erklärte das Orakel.
»Sie sollten nur fragen, was im Bereich der gegebe-
nen Möglichkeit liegt«, gab der Superior in sanftem
Ton zu verstehen.
Das Gesicht des Lords überzog sich mit einer star-
ken Röte. »Wie soll ich es am besten anstellen, um
meinem Sohn das Erbe zu erhalten?«
»In einem Staatswesen, das nicht äußeren Einflüs-
sen unterliegt, kann ein Herrscher durch Tradition,
Macht oder den Willen seiner Untertanen regieren.
Die letztgenannte Art des Regierens ist gewiß die be-
ständigste und fruchtbarste.«
»Weiter«, drängte der Voivode. »Du hast ohnehin
nicht mehr lange zu leben!«
»Seltsam«, erklärte das Orakel mit einem müden
Lächeln. »Da ich soeben erst begonnen habe, zu le-
ben.«
»Sprich, Orakel!« sagte der Superior mit scharfer
Stimme.

»Ihre Dynastie begann damit, daß Sie Ihren Vor-
gänger vergifteten. Es ist also keine Tradition vor-
handen. Es könnte Ihrem Sohn also gelingen, sich
weiterhin durch Gewalt an der Macht zu halten. Das
wäre im Prinzip sehr einfach. Er braucht nur einen
jeden zu beseitigen, der seine Herrschaft in Frage
stellt. Das wird ihm freilich neue Feinde schaffen, die
er nun wiederum beseitigen muß. Wenn er daher sei-
ne Widersacher schneller zu beseitigen vermag, als
diese ihre Kräfte zu vereinigen vermögen, dann wird
er an der Macht bleiben.«
»Undenkbar! Zu so etwas ist mein Sohn niemals in
der Lage. Ich selbst bin von Verrätern umgeben und
von speichelleckenden Höflingen, die nur auf mein
Ableben warten, um die Zeichen zu Raub und Plün-
derung zu geben.«
»In diesem Fall müßte Ihr Sohn die Qualifikation
eines Herrschers beweisen, so daß niemand ein Inter-
esse daran hat, ihn zu beseitigen.«
Lord Voivode schien in die Ferne zu blicken; viel-
leicht sah er das Gesicht seines Sohnes vor sich.
»Um die Situation in diesem Sinne zu ändern,
müßten Sie allerdings Ihre eigene Regierungsweise
erheblich ändern. Sie müßten eine jede Handlung ei-
nes Ihrer Beamten mit den Augen des geringsten
Bürgers Ihres Staates sehen und dementsprechend Ih-
re Anordnungen geben. Wenn Sie dann aus dem Le-
ben scheiden, wird Ihr Sohn von einer Welle des gu-
ten Willens und der Anerkennung getragen werden.«
Der Lord lehnte sich in seinem gepolsterten Sessel
zurück und sah den Superior fragend an. »Und dafür
habe ich mit zwanzig guten Sklaven und vier Gramm
reinem Kupfer gezahlt!«

Der Superior ließ sich noch immer nicht aus der
Ruhe bringen. »Das Orakel hat Ihre Fragen beant-
wortet. Es hat Ihnen in groben Zügen angedeutet, wie
Sie in Ihrer Situation am besten zu handeln vermö-
gen.«
»Aber es hat mir nichts Angenehmes gesagt!« pro-
testierte Voivode.
»Es hat Ihnen die Wahrheit gesagt, nicht mehr und
nicht weniger.«
»Also noch eine Frage: Die Delta-Leute sind in das
Tal zu Cridgin eingefallen und haben meine Rinder-
herden entführt. Durch den Morast können meine
Soldaten ihnen nicht folgen. Was kann ich dagegen
tun?«
»Pflanzen Sie auf den Hügeln des Impsidion
Buschwein an.«
Der Lord schluckte und lief erneut rot an. Der Su-
perior wandte sich an das Orakel. »Erkläre das bitte
ausführlicher.«
»Die Delta-Leute leben von Venusmuscheln. Seit
Jahrhunderten kultivieren sie Stämme von Venusmu-
scheln. Lord Voivode hat seine Tiere ständig auf den
Hügeln weiden lassen, so daß die Vegetation abstarb
und der Boden vom Regen in den Fluß gewaschen
wurde. Der Schlamm setzte sich auf den Venusmu-
scheln ab und brachte sie zum Absterben. Wenn
weitere Zwischenfälle vermieden werden sollen,
dann muß die Ursache beseitigt werden.«
»Die Delta-Leute sind unberechenbar und gefähr-
lich«, wandte Voivode ein. »Ich will Rache an ihnen
nehmen.«
»Diesen Wunsch werden Sie sich nicht erfüllen
können.«

Der Lord sprang auf, entwand einem seiner Diener
eine Tonschale und schleuderte sie nach dem Orakel,
traf es gegen die Brust. Der Superior stieß einen em-
pörten Schrei aus. Der Lord Voivode kümmerte sich
nicht weiter um die Anwesenden. Er stieg in seine
Sänfte und ließ sich aus der Halle hinaustragen.
Das Orakel hielt jetzt die Augen geschlossen; es
atmete in heftigen, aber unregelmäßigen Zügen. Seine
Hände ballten sich zusammen. Glystra wollte näher
auf das Orakel zugehen, wurde aber von Nymaster
zurückgehalten.
»Bleiben Sie stehen, wenn Ihnen Ihr Leben noch
etwas wert ist!«
Koromutin ging an ihnen vorüber und wisperte ih-
nen zu: »Wartet draußen im Korridor auf mich!«
Sie verließen hinter ihm den Raum. Nach endlos
erscheinenden zehn Minuten kehrte Koromutin in
seiner gewohnten Kleidung zurück. Wortlos führte er
sie eine Treppe hinauf. Durch große Bogenfenster sa-
hen sie auf die unter ihnen liegende Oase hinab.
Es ging noch einen Treppenabsatz höher, dann ver-
schwand Koromutin in einem kleinen Büro, das von
einem Mönch eingenommen wurde, der sein Zwil-
lingsbruder hätte sein können. Die beiden unterhiel-
ten sich lebhaft miteinander.
Koromutin wandte sich an Nymaster. »Das ist Jen-
tile, der Haus-Ordinarius. Er kann uns helfen – wenn
auch er einen solchen Dolch erhält, wie er mir ver-
sprochen worden ist.«
Nymaster zögerte kurz, gab dann aber seine Zu-
stimmung.
Der kleine Mann hinter dem Tisch erhob sich und
trat in den Gang hinaus.

»Er hat die Frau, die Sie suchen, bereits gesehen«,
erklärte Koromutin mit vertraulichem Unterton, »und
wird Sie zu ihrem Aufenthaltsort bringen. Ich über-
lasse Sie seiner Obhut.«
Damit zog er sich zurück. Jentile führte sie über
endlose Gänge und Treppen, bis Glystra plötzlich ein
lautstarkes Summen vernahm. Er blieb stehen und
lauschte.
»Was ist das?« fragte er.
»Sehen Sie durch dieses Gitter hindurch, und Sie
werden es selbst sehen. Es ist ein Kasten aus Metall
und Glas, aus dem ferne Stimmen sprechen. Ein
wundersames Instrument, aber dafür haben wir jetzt
keine Zeit.«
Glystra kam der Aufforderung nach und sah eine
moderne elektronische Apparatur vor sich, deren
Aufbau die Improvisation eines Fachmannes vermu-
ten ließ. Auf einem Tisch waren Lautsprecher, Mikro-
fon und verschiedene Kontrollgeräte angeordnet.
»Kommen Sie schon«, drängte Jentile. »Ich will
meinen eigenen Kopf noch länger auf den Schultern
behalten, auch wenn Sie keinen großen Wert darauf
zu legen scheinen.«

18
Jentile hielt vor einer schweren Holztür an. Er spähte
durch eine Ritze hindurch, wandte sich dann an
Glystra und sagte zu ihm: »Kommen Sie her und
überzeugen Sie sich selbst von ihrer Anwesenheit.
Dann müssen wir von hier weg. Der General-
Ordinarius kann jeden Augenblick auftauchen.«
Claude Glystra lachte grimmig auf und sah durch
die Ritze hindurch. Nancy saß in einem Lehnstuhl,
den Kopf mit geschlossenen Augen zurückgelehnt.
Sie trug lose Pyjamas; ihr Haar war hell und gepflegt.
Es sah so aus, als wäre sie soeben mit ihrer Toilette
fertiggeworden. Glystra vermochte den Ausdruck ih-
res Gesichts nicht zu deuten.
Er schob Jentile beiseite. »Nymaster, du kümmerst
dich um ihn!«
Er stieß die Tür auf.
Nancy starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an.
»Claude ...«
Langsam erhob sie sich. Sie stürzte ihm jedoch
nicht mit Freude und Erwartung entgegen, wie er es
erwartet hatte.
»Was ist geschehen?« fragte er ruhig.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte sie tonlos.
»Wir müssen schnell von hier weg.« Er legte seinen
Arm um ihre Schultern. Sie schien kraft- und willen-
los zu sein.
Jentile wurde von Nymaster festgehalten. Sein Ge-
sicht war empört und vor Angst verzerrt. Er brachte
jedoch keinen Laut hervor.
»Zurück in den Funkraum«, sagte Glystra. »Zu die-

sem Kasten aus Metall und Glas.«
Sie gingen den Weg zurück. Glystra hielt den Io-
nenstrahler in der einen Hand, mit der anderen um-
faßte er Nancy.
Das Summen kam näher.
Glystra stürmte in den Raum hinein. Ein hagerer
Mann mit einem blauen Kittel sah auf. »Immer schön
ruhig bleiben, dann geschieht dir nichts.«
Der Mann erhob sich, ohne den Blick von Glystras
Waffe zu lassen. »Du bist von der Erde, nicht wahr?«
»Na und?«
»Du hast dieses Gerät hier gebaut?«
»Was dagegen?«
»Im Gegenteil, ich finde es sehr praktisch. Verbinde
mich mit der Erdenklave.«
»Das werde ich nicht tun«, erklärte der Blaukittel
bestimmt. »Mein Leben ist mir mehr wert. Bedienen
Sie sich selbst, wenn Sie die Erdenklave haben wol-
len. Da Sie bewaffnet sind, kann ich Sie nicht davon
abhalten.«
Glystra trat einen Schritt vor. Der Mann zuckte
nicht mit der Wimper. »Stell dich neben dem Ordina-
rius an der Wand auf ... Nancy!«
»Ja, Claude?«
»Du stellst dich dort drüben hin, etwas abseits von
den anderen. Und bewege dich nicht.«
Langsam leistete sie seiner Anweisung Folge. Sie
schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich dann
aber offenbar anders.
Glystra setzte sich vor den Tisch und unterzog das
Gerät einer näheren Betrachtung. Es war eine recht
einfache Kurzwellenstation, wie sie Millionen von
Rundfunkamateuren auf der Erde ihr eigen nannten.

»Wie ist die Frequenz der Erdenklave?«
»Weiß ich nicht.«
Glystra fand ein Register und suchte darin den
Buchstaben E. »Erdenklave, offizielle Code-Nummer
181933«, las er vor. Er schaltete das Gerät ein und be-
gann an den Knöpfen zu hantieren.
Vom Gang her ertönten schwere Schritte. Die Tür
wurde aufgerissen. Ein Gesicht mit kantigen Zügen
und dichten grauen Augenbrauen sah herein. Au-
genblicklich warf sich der Haus-Ordinarius auf die
Knie. »Ehrwürdiger General-Ordinarius, es war nicht
mein Wille ...«
General-Ordinarius Mercodian sah über seine
Schulter zurück, in den Gang hinaus. »Nehmt diese
Männer gefangen!«
Glystra wandte sich erneut dem Sender zu. Noch
eine Ziffer ... Stämmige Gestalten stürmten in den
Raum. Nancy taumelte mit blutleerem Gesicht vor-
wärts. Sie verhielt genau in der Schußlinie. »Nancy!«
rief Glystra. Er hatte seinen Ionenstrahler gezogen,
aber sie stand genau zwischen ihm und dem General-
Ordinarius. »Verzeih mir«, wisperte er kaum hörbar.
»Es geht um mehr als dein Leben ...«
Er drückte den Abzug durch. Violettes Licht er-
leuchtete gespenstisch die Gesichter. Das Licht flak-
kerte nur kurz auf, erlosch wieder. Das Energieag-
gregat war verbraucht.
Drei Männer in schwarzen Roben stürzten sich auf
ihn. Er schlug wild um sich. Der Tisch mit den Gerät-
schaften stürzte um, obwohl der Techniker es ver-
zweifelt zu verhindern suchte. Nymaster nützte die-
sen Augenblick, um auf den Gang hinaus zu fliehen.
Seine Schritte hallten über den Korridor.
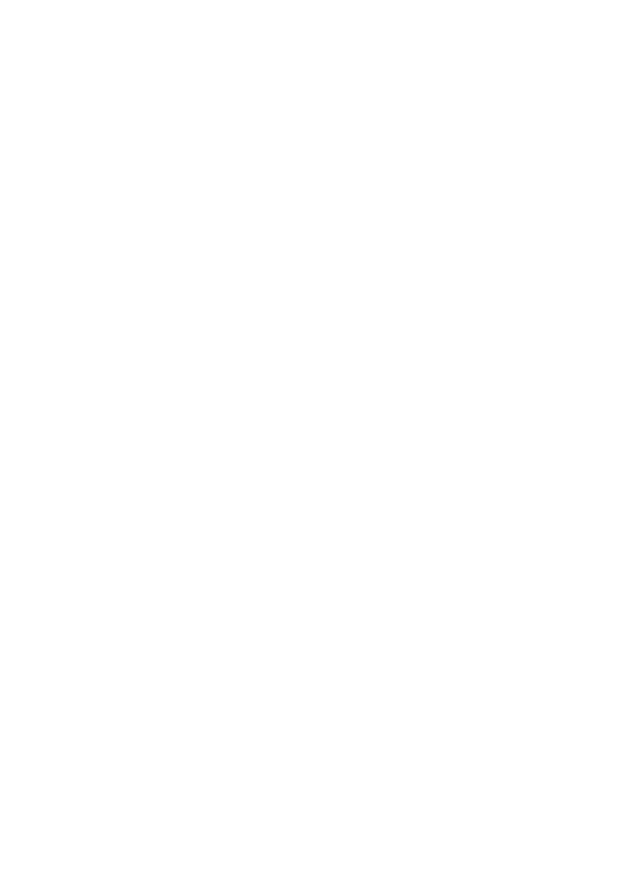
Glystra war bereits in eine der Ecken abgedrängt
worden. Die Schwarzgekleideten warfen ihn zu Bo-
den, trampelten auf ihm herum, banden ihm die
Hände auf den Rücken.
»Fesselt ihn besonders gut«, wies Mercodian an,
»und bringt ihn hinab!«
Er wurde die Korridore entlanggeschleppt, an den
hohen Arkaden vorbei, von denen aus die Oase zu
übersehen war.
Ein schwarzer Schatten glitt in geringer Höhe
durch die Luft. Glystra stieß einen heiseren Schrei
aus. »Ein Luftschweber – von der Erde!«
»Ein Luftschweber«, berichtigte Mercodian. »Aber
nicht von der Erde, sondern von Grosgarth.«
»Von Grosgarth?«
»Ich sagte es schon.«
Glystra zweifelte an seinem Verstand. »Es gibt in
Grosgarth nur einen, der über einen Luftwagen ver-
fügen könnte –«
»Richtig.«
»Weiß der Bajarnum vielleicht –«
»Er weiß, daß Sie hier sind. Glauben Sie wirklich,
daß er einen Luftschweber hat, aber kein Radio?«
Er wandte sich an die Schwarzgekleideten.
»Paßt auf diesen hier besonders gut auf! Ich muß
gehen, um Charley Lysidder zu begrüßen ...«
Glystra stand inmitten des Raumes auf dem steiner-
nen Fußboden. Seine Kopfhaare waren abrasiert
worden, und er hatte ein übelriechendes Bad in einer
essigähnlichen Flüssigkeit über sich ergehen lassen
müssen. Die Luft in der Gefangenenkammer war zum
Ersticken. Er atmete durch den Mund, um dem Ge-

ruch zu entgehen. Seltsam ... etwas in dem Aroma
war schwer und beißend, ein süßlicher Duft, betäu-
bend und anregend zugleich.
Zygagen!
Ja, das war es. Es war das gleiche Aroma, das er be-
reits vom Rauch brennender Zygagenzweige her
kannte.
Seine Gedanken kreisten immer schneller. Hatte
der Wirkstoff der Zygagen vielleicht etwas mit dem
Serum zu tun, mit dem das Orakel für seine letzten
Dienste vorbereitet wurde?
Wie wirkte diese Droge überhaupt? Glystra konnte
sich von dieser Frage nicht lösen, die eigentlich von
einem Wissenschaftler hätte beantwortet werden
müssen. Offenbar brachte die Droge die in einem
Menschenleben gesammelten Erfahrungen, Eindrük-
ke und Denkansätze hervor, die jahrelang im Unter-
bewußtsein eines Individuums zwar vorhanden ge-
wesen waren, aber nie bis zur Oberfläche gelangt wa-
ren.
Die Orakel-Droge ließ einen Menschen an die Stufe
des Todes herantreten und sich zum erstenmal seines
wirklichen Wissens um die Natur bewußt werden.
Ein Wesen, das einen solchen Höhepunkt der Weis-
heit erreichte, mußte wenig später mit seinem Tod
dafür bezahlen.
In gewisser Weise glich das den Folgen, die das
Einatmen des Zygagenrauches bei ihnen bewirkt
hatte. Sein Denkvermögen hatte plötzlich ausgesetzt,
als wäre ein Uhrwerk abgestellt worden. Steve Bishop
hingegen hatte nicht unter diesen Nachwirkungen zu
leiden gehabt. Vielmehr war bei ihm ein gesteigertes
Wohlbefinden die Folge gewesen, ebenso wie gestei-

gerte Fähigkeiten. Offenbar hatten ihm seine Vitami-
ne dabei geholfen.
Vitamine? War das Orakel vielleicht an Vitamin-
mangel gestorben?
Glystra beschäftigte sich mit dieser Idee. Langsam
ging er auf dem Steinboden auf und ab.
»Ssst!«
Glystra sah auf. Ein feindseliges Auge spähte durch
einen Spalt in der Tür. Es war Nymaster.
»Und jetzt bist du gefangen«, sagte der Sohn des
Händlers mit leiser Stimme. »Du wirst sterben müs-
sen. Koromutin sagt, daß du ausgewählt wurdest, das
Orakel zu spielen. Für Charley Lysidder. Er hat es
vom Superior erfahren, während er von diesem ge-
schlagen wurde.«
»Kannst du mich nicht durch Bestechung freibe-
kommen? Ich habe noch einige von den Schwertern,
wie du sie gesehen hast.«
»Das wäre jetzt selbst mit einer ganzen Tonne Eisen
nicht mehr möglich.«
Glystra schwieg.
»Und was soll jetzt mit meinem Vater geschehen?«
fragte Nymaster. »Wenn Elton deiner Anordnung
folgt, wird er ihn töten.«
»Bring mir ein Stück Papier. Ich werde Elton
schreiben.«
Nymaster schob ihm ein fettiges Papierstück und
einen scharfen Granitstein hindurch. Glystra kritzelte
eine Botschaft an Elton darauf und reichte das Papier
zurück.
»Ich habe ihm mitgeteilt, daß du noch einmal zu
mir zurückkommen wirst. Er wird dir ein kleines

Päckchen geben, das du mir bringen sollst. Dafür er-
hältst du ein weiteres Schwert.«
Nymaster schien zu zögern. »Es ist ein ungeheures
Wagnis. Aber ich werde es versuchen.«
Eine gute Stunde später kehrte er wieder zurück.
Er brachte, was Glystra verlangt hatte: ein kleines
Päckchen, das Vitamintabletten enthielt.
Nymaster verabschiedete sich von ihm, als zählte
er fast schon nicht mehr zu den Lebenden.
Glystra selbst hegte die Hoffnung, am nächsten Tag
durchaus noch unter den Lebenden zu weilen. Wenn
seine Kombinationen nicht falsch waren ...

19
Die Sonne verschwand hinter den Gärten am Myrten-
see. Vom Osten her brach die Dämmerung herein,
bewegte sich auf den marmornen Pavillon zu, der
sich auf der Ostseite der riesigen Kuppel befand, um-
kränzt von schlanken Säulen.
Vier schlanke junge Männer traten aus der Tem-
pelkuppel heraus. Sie trugen Fackeln mit sich, die sie
in hölzerne Ständer steckten, und kehrten schwei-
gend wieder um.
Die Dämmerung wich der hereinbrechenden
Nacht.
Stimmen ertönten vom Tempel her. Mercodian, der
General-Ordinarius vom Myrtensee, und Charley Ly-
sidder, der Bajarnum von Beaujolais, traten in den
Lichtkreis, der von den Fackeln ausging.
Die Festlichkeiten begannen, in deren Verlauf das
Orakel, das auf den Namen Claude Glystra gehört
hatte, seine Weisheit preisgeben – und den Preis da-
für auch noch selbst bezahlen würde.
Glystra wurde mit verbundenen Augen auf seinen
Platz gebracht. Mehrere Arme hielten ihn fest, und
dann spürte er, wie die Nadel der Spritze tief in sei-
nen Nacken eindrang.
Eine große schwarze Hand schien nach seinem Ge-
hirn zu greifen. Dunkelheit umfaßte ihn, ließ ihn ver-
gessen.
Die Stimme des General-Ordinarius drang an sein
Ohr. »Bajarnum, jetzt liegt sein Gehirn klar und offen
vor Ihnen. Beeilen Sie sich, denn in wenigen Minuten
schon wird ihn sein Leben verlassen.«

Er öffnete die Augen. Die Kopfbinde war ihm in-
zwischen abgenommen worden. Er fühlte sich wie
von ungeahnten Kräften durchflutet.
Er erkannte den Mann neben Mercodian augen-
blicklich. Es mußte der Bajarnum sein – aber er
kannte ihn unter einem anderen Namen, nämlich
Arthur Hidders. Der Pelzhändler, der im gleichen
Schiff wie sie auf den Großen Planeten gekommen
war. Eine gute Tarnung für einen Despoten des Gro-
ßen Planeten, um Waffen- und Sklavengeschäfte auf
der Erde zu tätigen ...
Neben Hidders-Lysidder-Bajarnum stand Nancy,
kreidebleich, das Gesicht dem Boden zugewandt. Ihm
entging nicht, daß ihre Augen mit Tränen gefüllt wa-
ren. Glystra verstand jetzt die Rolle, die sie gespielt
hatte.
»Beeilen Sie sich, Bajarnum, wenn Sie sein Wissen
haben wollen«, drängte Mercodian.
Charley Lysidder erhob seine Stimme. »Wie kann
ich von der Waffenkontrolle des Systems Waffen kau-
fen? Wen muß ich dazu bestechen?«
Glystra sah auf den Bajarnum hinab, dann auf
Mercodian, zuletzt auf Nancy. Er konnte seine Ge-
sichtszüge kaum beherrschen, so lächerlich erschien
ihm diese Situation.
Der Bajarnum wiederholte seine Frage.
»Versuchen Sie es mit Alan Marklow«, sagte
Glystra, als gäbe er ein großes Geheimnis preis.
Der Bajarnum beugte sich erregt nach vorn. »Mar-
klow? Der Vorsitzende des Obersten Kontrollrats?«
Das Lächeln auf seinem Gesicht wirkte teilweise är-
gerlich, teilweise ungläubig. »Alan Marklow also ist
käuflich?«

»Ebensogut wie jedes andere Mitglied des Rates«,
erklärte Glystra. »Darin liegt mein Rat begründet.
Wenn Sie unbedingt jemanden bestechen wollen, ist
es doch zweifellos am besten, Sie beginnen gleich bei
der Spitze.«
Der Bajarnum starrte ihn stumm an. Der General-
Ordinarius verengte seine Augen zu schmalen Schlit-
zen und schnellte von seinem Sitz hoch.
»Wenn ich Sie richtig verstanden habe«, fuhr
Glystra fort, »dann brauchen Sie Waffen, um Ihr
Reich noch weiter ausdehnen zu können. Ist das rich-
tig?«
»Ja, so könnte man es ungefähr sagen.«
»Was bewegt Sie zu diesen Absichten?«
Mercodian machte eine Bewegung, wollte offenbar
eine Anweisung geben. Statt dessen preßte er jedoch
lediglich seine Lippen zu einer schmalen Linie zu-
sammen.
»Ich will, daß mein Name für alle Zeiten mit Ruhm
verbunden sein wird. Grosgarth soll die Hauptstadt
der Welt werden, und ich will all meine Feinde ver-
nichten.«
»Das ist ebenso lächerlich wie sinnlos!«
Lysidder war sichtlich unangenehm berührt und
wandte sich an Mercodian. »Sind das vielleicht die
üblichen Antworten?«
»Keineswegs, Bajarnum.« Er konnte seine Wut
nicht mehr länger im Zaum halten. »Was für ein Ora-
kel bist du«, fuhr er Glystra an, »daß du Fragen aus-
weichst und dich mit dem Fragensteller herumzu-
streifen beginnst? Du mußt dir dessen bewußt sein,
daß dein eigenes Ich durch die Droge der Weisheit
ausgeschaltet ist. Ich befehle dir, präzise auf die Fra-

gen des Bajarnum zu antworten. Er will noch viel von
dir wissen, bevor du stirbst, und das wird in wenigen
Minuten sein!«
»Vielleicht war meine Frage nicht so ganz exakt«,
lenkte Bajarnum ein und wandte sich erneut an
Glystra. »Wie kann ich mir billig metallene Waffen
besorgen?«
»Indem Sie der Raumpatrouille beitreten. Dann er-
halten Sie einen Ionenstrahler und ein Taschenmesser
völlig kostenlos.«
Mercodian japste nach Luft, während sich tiefe
Falten in die Stirn des Bajarnum gruben. Die Befra-
gung verlief bei weitem nicht so, wie sie es erwartet
hatten. Lysidder versuchte es ein drittes Mal. »Ist es
denkbar, daß sich die Erd-Zentrale ernsthaft in die
Angelegenheiten des Großen Planeten einmischen
wird?«
»Das ist in der Tat höchst wahrscheinlich«, ant-
wortete Glystra, wohl wissend, daß dies der Wahrheit
entsprach. Er überlegte zugleich, daß es für ihn nun
wohl an der Zeit war, zu sterben, und sank auf sei-
nem Sitz in sich zusammen.
»Das war wenig zufriedenstellend«, gab Mercodian
zu.
Charley Lysidder kaute auf seinen Lippen herum
und musterte Glystra aufmerksam. Nancy starrte
ausdruckslos vor sich hin; es gelang Glystra bei aller
Konzentration nicht, hinter ihre Gedanken zu kom-
men.
»Eine letzte Frage«, kündigte der Bajarnum an.
»Wie kann ich mein Leben verlängern?«
Mit großer Mühe nur gelang es Claude Glystra,
seine Bewegungen zu kontrollieren. Mit tonloser

Stimme antwortete er: »Indem du dir ebenfalls die
Droge der Weisheit verabreichen läßt.«
Der General-Ordinarius spuckte wütend aus. »Die-
sem Geschöpf ist nicht beizukommen! Wäre er nicht
schon so gut wie tot, würde ich ihn eigenhändig mit
dem Schwert durchbohren.«
Glystra war inzwischen auf seinem Sitz völlig in
sich zusammengesunken. Mercodian ließ ihn fort-
bringen.
»Es war ein bedauernswerter Fehler, Bajarnum.
Wenn Sie wünschen, werde ich sogleich ein zweites
Orakel vorbereiten lassen.«
Der Bajarnum reagierte nicht auf seinen Vorschlag.
»Wenn ich nur wüßte, was er gemeint hat ...«
Glystra wurde in einen Raum geschafft, in dem be-
reits mehrere Tote aufgebahrt lagen. Er wartete ab,
bis die Nachtwache ihre Runde machte, und machte
sich auf und davon. Er gelangte unbemerkt wieder
aus der Kuppel heraus und kehrte durch Zellos Gar-
ten hindurch zur Basarstraße zurück. Nymaster, sein
Vater und Elton, glaubten kaum ihren Augen, als sie
ihn wiedersahen. Glystra ließ sich ein Bad anrichten
und erzählte dann, wie er seine Rolle als Orakel
überlebt hatte – dank einer größeren Menge von Vit-
amintabletten.
»Und wie geht es jetzt weiter?« wollte Elton
schließlich wissen.
»Und jetzt geht es Charley Lysidder an den Kra-
gen«, erklärte Claude Glystra.
Eine halbe Stunde später schlichen zwei schatten-
hafte Gestalten zu dem mit Marmor ausgelegten Platz
hinüber, auf dem Charley Lysidders Luftschweber

gelandet war. An der Kabinentür lehnte eine Gestalt,
die eine rote Jacke anhatte und einen Ionenstrahler an
einem Schulterband trug.
»Wie machen wir's«, wisperte Glystra.
»Erst müssen wir mit ihm fertigwerden«, meinte
Elton. »Fliegen kann ich das Ding.«
»Gut. Ich gehe auf die andere Seite. Du lenkst ihn
irgendwie ab.« Er verschwand in der Dunkelheit.
Elton wartete gute zwei Minuten. Dann trat er vor
und richtete seinen Strahler auf die Wache. »Keine
Bewegung!«
Der Mann sah ihn herausfordernd an. »Was soll –«
Glystra erschien hinter ihm. Ein dumpfes Geräusch –
die Wache sackte in sich zusammen. Glystra nahm
den Ionenstrahler aus der Tasche am Schulterband
und winkte Elton. »Auf!«
Die Oase vom Myrtensee fiel unter ihnen zurück.
Glystra lachte befreit auf. »Wir haben es geschafft,
Asa! Wir sind frei ...«
Elton blickte über das weite Panorama hinweg.
»Das glaube ich erst, wenn wir in der Erdenklave
sind.«
»Erdenklave?« Glystra sah ihn überrascht an.
»Willst du vielleicht lieber nach Grosgarth?«
»Natürlich nicht. Aber denk mal nach. Wir sind
doch in der besten Position. Charley Lysidder sitzt
am Myrtensee fest. Sein Luftschweber ist weg, die
Funkanlage nicht mehr zu gebrauchen. Selbst wenn
er noch einen Luftschweber haben sollte, kann er ihn
nicht herbeirufen.«
»Bleibt ihm die Monobahn«, warf Elton ein. »Die ist
auch nicht langsam. In vier Tagen kann er wieder in
Grosgarth sein.«

»Genau. Er muß die Monobahn benutzen, und das
ist unsere Chance.«
»Wie das? Er wird sich gewiß nicht auf den Weg
machen, ohne sich bis an die Zähne zu bewaffnen.«
»Daran kann es keine Zweifel geben. Vielleicht
schickt er auch nur einen Boten zurück nach Gros-
garth, um einen anderen Luftschweber kommen zu
lassen, sofern er noch einen hat. Wir müssen uns also
erst einmal vergewissern. Ich entsinne mich an einen
Ort, wo die Monobahn dicht an einem Felsplateau
vorbeiführt. Dort werden wir auf ihn warten.«

20
Sie mußten sich bis am nächsten Morgen gedulden.
Ungefähr zwei Stunden nach Sonnenaufgang kam
aus der Richtung des Myrtensees ein kleiner, dunkler
Punkt auf sie zu.
»Der Bajarnum kommt«, erklärte Glystra befriedigt.
Der Wagen kam über die Wüste hinweg näher, im
Spiel des Windes hin- und herschwingend. Sie konn-
ten schließlich erkennen, daß es eine langgestreckte
Frachtgondel war.
Mit summenden Rädern rauschte der Wagen an
ihnen vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung We-
sten fort. Sie konnten deutlich vier Männer und eine
Frau unterscheiden, während sie selbst sich hinter ei-
nem Felsvorsprung so in Deckung hielten, daß sie
nicht gesehen werden konnten.
»Das waren Lysidder, drei seiner Vasallen und
Nancy. Und sie wirkten nicht besonders fröhlich.«
»Aber sie hatten ihre Strahler griffbereit. Sie schei-
nen uns zu erwarten.«
»Ich habe mitnichten vor, mich ihnen zu nähern.«
Sie erhoben sich und gingen zum Luftschweber zu-
rück.
»Ich möchte zu gerne mal wissen, was du vorhast«,
murrte Elton. »Wenn du mich fragst, dann treibst du
dieses Superhelden-Spielchen ein wenig zu weit.«
Sie überflogen die weite Hochfläche, auf der sich
noch vor wenigen Tagen ihre Flucht vor den Rebbirs
abgespielt hatte. Sie schwebten in das Tal hinunter,
wo das Kabel, von den hohen Felsgraten herabfal-
lend, auf eine Plattform zulief. Sie landeten unter ei-
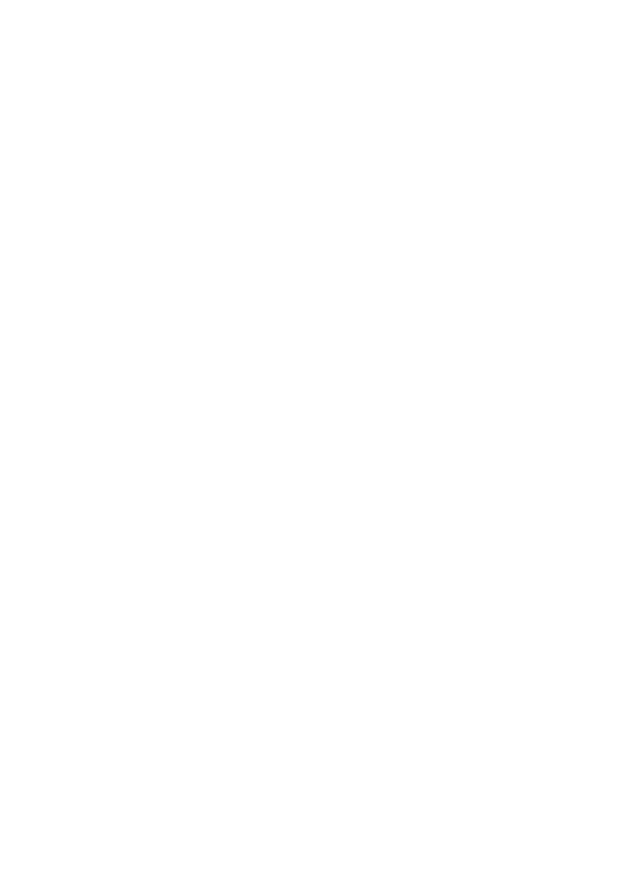
nem der Stützpfeiler der Monobahn.
»Wir werden jetzt mutwillig das oberste Gebot Os-
riks verletzen, nämlich das Kabel durchschneiden.
Und das sogar mehrmals. Zunächst nehmen wir die
Länge zwischen zwei Stützpfeilern heraus.«
Glystra kletterte an einem Stützpfeiler hinauf und
trennte das Kabel der Monobahn durch. Elton machte
es ihm beim nächsten Pfeiler in gleicher Weise nach.
»Gut. Jetzt legen wir dieses Seilstück doppelt und
befestigen es so am Unterbau des Schwebers, daß wir
zwei freie Seilenden bekommen.« Nachdem sie das
erledigt hatten, starteten sie den Schweber erneut und
landeten im Schatten der Plattform, von der aus sich
das Kabel zum Felsgrat hochschwang. Glystra stieg
zur Plattform hoch. »So, und jetzt wird ein Seilende
mit ein paar kräftigen Knoten an diesem Kabelstück
befestigt.«
»Mir geht ein Licht auf«, grinste Elton. »Ich fürchte
nur, der Bajarnum wird wenig Freude daran haben.«
»Den brauchen wir ja nicht unbedingt zu fragen.
Setz dich vorsichtshalber in den Schweber – für den
Fall, daß das Kabelgewicht zu stark durchzieht. Fer-
tig?«
»Fertig.«
Glystra hatte mittlerweile ein Seilende des am
Schweber befestigten Seils mehrfach mit dem ver-
knotet, das sich zwischen der Plattform und dem
Felsgrat spannte. Das Gewicht dieses Seils hätten sie
aus eigener Kraft niemals halten können.
Glystra schnitt das Kabel ein gutes Stück vor sei-
nem Knoten durch, so daß das Kabel vom Felsgrat
herab jetzt nicht mehr zur Plattform, sondern direkt
zum Luftschweber führte, der jetzt gewissermaßen

einen Grundanker der Monobahn hergab.
Glystra ging zu Elton zurück. »Sie dürfen in etwa
einer Stunde hier auftauchen. Wenn es der Wind gut
mit ihnen meint, sogar etwas eher.«
»Sie kommen!« Die Zeit war schnell vorübergegan-
gen. Elton sah, wie die Gondel sich über den Felsgrat
hinausschob.
»Jetzt dürfte die schönste Fahrt ihres Lebens begin-
nen«, freute sich Glystra.
Der kleine Punkt kam rasend schnell näher und
blieb doch noch ein kaum auszumachender Punkt vor
der steil aufragenden Felswand. »Wenn wir jetzt das
Gesicht des Bajarnum sehen könnten ...«
Er drückte den Hebel durch, und der Luftschweber
hob ab, stieg steil empor, bis er die Höhe des Grates
erreicht hatte. Die Frachtgondel unter ihnen rollte in
den untersten Teil der Schleife hinab und blieb aus-
weglos hängen. Die Passagiere darin waren kaum
besser als kleine schwarze Punkte auszumachen, aber
es sah aus, als gestikulierten sie heftig.
Glystra dirigierte den Schweber zum Grat hinüber
und setzte ihn an der dortigen Plattform auf.
Er verknotete das zweite freie Seilende des Schwe-
bers mit dem an der Plattform auslaufenden Kabel,
durchschnitt dieses dann und hatte nun die Fracht-
gondel an einer langen Kabelschleife unter ihrem
Schweber hängen.
Glystra blickte hinab. »Dort unten hängt er, der
Bajarnum von Beaujolais. Gefangen wie eine Maus in
der Falle, ohne daß wir Hand an ihn zu legen
brauchten.«
»Sie haben noch immer ihre Waffen«, wandte Elton
ein. »Wo immer wir sie niedersetzen – und sollte es in

der Erdenklave sein – werden sie auf uns schießen.«
»Das werden sie nicht. Eine kleine erfrischende
Dusche im See wird sowohl Charley Lysidders Tem-
perament abkühlen, als auch die Ionenstrahler durch
Kurzschluß gebrauchsunfähig machen.«
Charley Lysidder war bleich vor Wut und Enttäu-
schung, als er am Ufer des Sees stand. Die drei edlen
Vasallen in seiner Begleitung hingegen vermochten
noch etwas von ihrer Haltung zu bewahren, obwohl
ihnen das Wasser aus den Stiefeln rann. Nancy
hockte frierend am Strand, und ihre Zähne klapper-
ten hörbar.
Glystra warf ihr einen Überwurf zu. Den Ionen-
strahler in der Hand, wandte er sich den anderen zu.
»Ihr geht einer nach dem anderen in den Schweber
hinein. Elton wird euch nach Waffen und ähnlich un-
nützem Zeug durchsuchen.« Er wies auf den Bajar-
num. »Du gehst zuerst.«
Elton brachte bei seinen Untersuchungen drei Dol-
che und die unbrauchbaren Strahler zum Vorschein.
Im Schweber bedeuteten sie ihren Gefangenen, daß
sie sich so weit hinten wie möglich zu halten hatten.
Lysidder faßte wieder Mut. »Dafür werde ich mich
revanchieren. Und wenn ich noch hundert Jahre le-
ben muß!«
Glystra lachte. »Die Wut macht dich blind. Wenn es
eine Revanche gibt, dann für die hunderttausend
Männer, Frauen und Kinder, die du auf andere Wel-
ten verkauft hast.«
»Das ist eine erfundene Zahl.«
»Ob hundert oder hunderttausend, es ist das glei-
che Verbrechen.«

Glystra ließ sich neben Elton auf dem Pilotensitz
nieder. »Glaubst du, daß du die Erdenklave finden
kannst?«
»Ich hoffe es.« Seine Finger glitten über das Arma-
turenbrett.
Der Schweber hob ab und flog in westlicher Rich-
tung davon.
Lysidder war damit beschäftigt, die Feuchtigkeit
aus seiner Tunika zu wringen. Er gewann zusehends
wieder an Haltung. »Ich glaube, du tust mir Unrecht,
Claude Glystra. Ich habe Menschen verkauft, die oh-
nehin dem Verderben preisgegeben waren, zumeist
dem sicheren Hungertod. Das ist nicht rechtens, zu-
gegeben. Aber mußten nicht auch auf der Erde Tau-
sende um der Befreiung willen sterben?«
»Soll heißen, es war Ihre Absicht, den Großen Pla-
neten zu befreien?«
»Richtig.«
»Aber warum?«
Der Bajarnum sah ihn an. »Aber das ist doch keine
Frage. Würde dann nicht Ruhe und Frieden herr-
schen?«
»Nein, und das müßtest du selbst wissen. Der Gro-
ße Planet kann nicht durch Eroberungen vereinigt
werden. Schon gar nicht von einer Armee auf Zipan-
goten und zu deinen Lebzeiten. Daß du dich für Ge-
setz und Ordnung einsetzen würdest, ist abgesehen
davon ohnehin nicht anzunehmen. Deine Armee ist
in Wale und Glaythree eingefallen und hält diese
Länder besetzt. Zur gleichen Zeit aber rauben die Zi-
geuner und Rebbirs, wie sie nur können, und nie-
mand hindert sie daran.«
Nancy sah den Bajarnum zweifelnd an.

»Deine Eroberungen«, fuhr Glystra fort, »dienten
lediglich deinem Egoismus und deiner persönlichen
Eitelkeit. Du bist keinen Deut besser als Atman der
Gnadenlose, nur mit dem Unterschied, daß du etwas
vornehmere Kleider trägst.«
»Das ist alles nichts als leeres Gerede«, zischte Ly-
sidder. »Die Kommissionen von der Erde kommen
und gehen. Der Große Planet verschlingt sie alle. So
ist es seit vielen Generationen. Und noch immer wird
geredet.«
»Diese Kommission ist anders«, gab Glystra grin-
send zu verstehen. »Oder sagen wir besser, was noch
von ihr übrig ist. Ich habe mir umfassende Machtbe-
fugnisse bestätigen lassen, bevor ich diese Position
angenommen habe. Ich empfehle nicht – ich befehle.«
»Angenommen, das trifft zu. Was würdest du un-
ternehmen?«
Glystra zuckte mit den Schultern. »Ich habe Ideen,
aber noch kein Programm. Eines aber ist gewiß: Mord
und Sklaverei werden ein Ende haben.«
Der Bajarnum stieß ein höhnisches Lachen aus.
»Du wirst also waffenstarrende Kampfschiffe von der
Erde kommen lassen, um die Zigeuner, die Rebbirs,
die Nomaden und all die anderen Steppenbewohner
auszurotten – also all die wandernden Stämme des
Großen Planeten. Und das alles, um ein von der Erde
kontrolliertes Reich aufzubauen anstelle des Reiches
von Beaujolais, das ich errichten wollte.«
»Du hast das wesentliche offenbar nicht verstan-
den«,
entgegnete
Glystra.
»Der
Große
Planet
kann
nie-
mals zwangsweise geeint werden – ebensogut könnte
man Enten, Katzen, Affen, Fische und Elefanten zu
einem Staat zusammenfassen. Vermutlich werden

tausend oder mehr Jahre vergehen, bevor eine ein-
heitliche Regierung des Großen Planeten denkbar
wird. Ein von der Erde beherrschter Großer Planet
wäre bei weitem zu kostspielig und würde vermut-
lich der Macht der Willkür anheimfallen – nicht we-
niger schlimm wie derzeit das Reich von Beaujolais.«
»Was also willst du unternehmen?«
Glystra zuckte erneut mit den Schultern. »Regio-
nale Organisationen, unterstützt durch örtliche Gar-
deeinheiten.«
»Also das ganze überlebte System der Erde!« Der
Bajarnum rümpfte beleidigt die Nase. »In spätestens
fünf Jahren, sind deine regionalen Befehlshaber zu
Tyrannen geworden, schlimmer als alle vorherge-
henden Herrscher. Die regionalen Richter werden be-
stechlich sein und die für die Politik verantwortlichen
Leute werden nach eigenem Gutdünken Gebiete un-
terwerfen.«
»Das alles liegt durchaus im Bereich des Mögli-
chen, aber es wird einer Kontrolle unterliegen.«
Eine Zeit verstrich. »Was hast du eigentlich mit uns
vor?« erkundigte sich Lysidder.
Glystra sah durch die Sichtscheibe hinaus. »Das
wirst du in zwei Stunden erfahren.«
Sie flogen über einen See hinweg, über graue Wü-
stenstriche und Bergketten. Die Landschaft unter ih-
nen wechselte in rascher Folge. Als sie über einem
gewellten Gebiet schwebten, in dem zahlreiche Wein-
felder angelegt waren, wandte sich Glystra an Elton.
»Ich schätze, das ist weit genug. Hier machen wir ei-
ne kurze Zwischenlandung.«
In Lysidders Gesicht begann es zu arbeiten. »Was
hast du vor?«

»Ach, nichts weiter. Ich habe mich entschlossen,
euch laufen zu lassen. Du kannst ja versuchen, nach
Grosgarth zurückzukehren, aber ich glaube nicht, daß
du es schaffst. Du wirst also hierbleiben und für dei-
nen Lebensunterhalt arbeiten müssen, wie ich es sehe
– und das ist wohl die schrecklichste Strafe für den
Bajarnum von Beaujolais, die man sich überhaupt
ausdenken könnte.«
Sie setzten Lysidder und seine drei Vasallen ab und
flogen sogleich weiter. Die Gestalten unter ihnen
wurden rasch kleiner: Harlekine in prunkvollen Ge-
wändern, die steif und bewegungslos dem abheben-
den Luftschweber nachstarrten. Endlich verlor Char-
ley Lysidder seine Selbstbeherrschung und schüttelte
eine drohend geballte Faust hinter ihnen her.
Glystra grinste. »Der Bajarnum von Beaujolais ge-
hört der Vergangenheit an.«
Die Landschaft des Großen Planeten schwand
langsam im Dämmerlicht des späten Nachmittags
dahin. Glystra vermochte die schweigende Gestalt im
rückwärtigen Teil des Schwebers nicht mehr weiter
zu ignorieren. Er ging nach hinten und ließ sich ne-
ben ihr nieder.
»Ich möchte gern annehmen«, begann er, »daß du
nichts als ein willenloses Werkzeug des Bajarnum
gewesen bist, und ich werde dafür sorgen –«
Sie unterbrach ihn leise, aber leidenschaftlich. »Ich
werde dich nie davon überzeugen können, daß wir
im Grunde für das gleiche Ziel gearbeitet haben.«
Glystra dachte an den langen Marsch zurück und
an seine toten Begleiter. Sie hatte sich mitschuldig
gemacht durch die Rolle, die sie spielte.
»Ich weiß, wo deine Gedanken jetzt sind«, sagte sie.

»Aber hör mich erst einmal an. Und dann setze mich
mitten im Ozean aus, wenn du willst.«
Er nickte stumm.
»Die Zigeuner haben mein Zuhause verbrannt und
alles, was sich darin befand«, setzte sie mit tonloser
Stimme an. »Es war, wie ich es dir bereits erzählt ha-
be. Ich bin nach Grosgarth gegangen; Charley Lysid-
der hat mich während des Mittsommernachtfestes
entdeckt. Er verkündete den Krieg gegen die ganze
Welt, und ich dachte, daß das die einzige Chance des
Friedens für den Großen Planeten wäre. Er nahm
mich in seine Dienste, und warum hätte ich mich da-
gegen sträuben sollen? Er nahm mich auch mit zur
Erde, und auf dem Rückweg erfuhren wir von euren
Plänen. Offensichtlich ging es euch einzig allein dar-
um, Charley Lysidder zu verfolgen und von seinen
Plänen abzuhalten. Ich trug große Bitternis gegen die
Erde und all ihre Bewohner in mir. Sie lebten in Si-
cherheit und Wohlstand, während auf dem Großen
Planeten die Urenkel einstiger Erdbewohner gequält
und getötet wurden. Warum kamen sie uns nicht zu
Hilfe?«
»Ich verstehe«, sagte Glystra. »Aber warum hast du
während des Marsches nichts gegen mich unter-
nommen? Du hättest tausendfache Möglichkeiten da-
zu gehabt.«
»Ich begann dich zu lieben und mußte dich doch
bekämpfen. Es gelang mir beides nicht. Es ist mir
schwer genug geworden, mit dem Wissen um all die-
se Dinge täglich mit dir zusammen zu sein. Lysidder
nahm später natürlich an, ich hätte euch bewußt zum
Myrtensee geführt, um euch dort gefangennehmen zu
lassen.«

»Wie war das, als sie Bishop umbrachten?«
»Damit hatte ich nichts zu tun. Ich bin in Richtung
auf die Tempelkuppel gegangen, und er folgte mir,
wurde von den Männern Mercodians ergriffen.«
»Und Pianza?«
Sie schüttelte müde den Kopf. »Die Händler hatten
Pianza bereits umgebracht. Ich konnte sie nur noch
davon abhalten, euch alle zu töten. Ich habe ihnen
aber gestattet, die Gondeln mitzunehmen, weil ich
damit erreichen wollte, daß du nach Kirstendale zu-
rückkehrst, wo wir glücklich und unbehelligt hätten
leben können.« Sie sah ihn an und senkte dann den
Blick. »Ich kann es dir nicht verdenken. Du glaubst
mir kein Wort.«
»Im Gegenteil, ich glaube dir alles. Ich wünschte
nur, ich hätte deinen Mut.«
»Ihr beide macht mir immer mehr Spaß!« rief Elton
von vorne. »Gebt euch doch endlich einen Kuß, und
die Sache ist erledigt.«
Glystra und Nancy saßen noch eine Zeitlang
schweigend zusammen. »Wir haben viele unverrich-
tete Dinge hinter uns zurückgelassen«, sagte Glystra
schließlich. »Auf dem Rückweg werden wir eine
kleine Zwischenlandung in Kirstendale einlegen und
die Dienste von Sir Roger Fayne in Anspruch neh-
men, der uns in einer schönen und großen Kutsche
durch die Stadt ziehen wird.«
»Da bin ich mit dabei!« lachte Elton. »Und ich wer-
de eine lange Peitsche mitnehmen.«
Document Outline
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Heyne 03256 Vance, Jack Planet Der Ausgestossenen
Vance, Jack Kaste Der Unsterblichen(1)
Vance, Jack Kaste Der Unsterblichen
Moewig Vance,Jack Kaste Der Unsterblichen
Bastei Vance, Jack Krieg Der Gehirne
Heyne 3448 Vance, Jack Durdane 1 Der Mann Ohne Gesicht
Bastei Vance, Jack Krieg Der Gehirne(1)
Vance, Jack Durdane 1 Der Mann Ohne Gesicht
Ebook (German) @ Sci Fi @ Vance, Jack 1958 Der Neue Geist Von Pao
Vance, Jack Der Azurne Planet
Ullstein Vance, Jack Tschai 01 Die Stadt Der Khasch
Vance, Jack Die Stadt der Khasch
Vance, Jack Sf Die Stadt Der Khasch
Jack Vance Das Gehirn Der Galaxis
Vance, Jack Im Reich Der Dirdir
Heyne 3463 Vance, Jack Durdane 02 Der Kampf Um Durdane
Vance, Jack 3 Im Reich Der Dirdir
Knaur Vance, Jack Die Augen Der Überwelt
więcej podobnych podstron